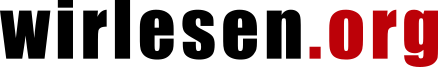Die Literaturhistorie der Moderne verzeichnet bei der Kurzgeschichte große, noch heute viel gelesene Namen, so unter anderen Anton Tschechow, Franz Kafka, Sherwood Anderson, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, William Faulkner und Katherine Mansfield. Dass die short story bis heute in der angloamerikanischen Literatur überaus präsent und sehr geschätzt ist, hängt auch damit zusammen, dass es noch immer lukrative Publikationsmöglichkeiten und größeren Raum in Publikumsmagazinen wie etwa „The New Yorker“ oder „The Atlantic“ und in Journalen, die in Literaturfakultäten von Universitäten angesiedelt sind, etwa der „Sewanee Review“, gibt.
AutorInnen aus aller Welt und der Nobelpreis
Aus diesem Grund nehmen Kurzgeschichten einen beträchtlichen, wenn nicht sogar überwiegenden Teil im Schaffen der Engländer Roald Dahl, Rudyard Kipling oder V. S. Pritchett ein. Jenseits des Atlantiks findet man sie im Werk Grace Paleys, John Cheevers und John Updikes, Raymond Carvers und Harold Brodkeys, Donald Barthelmes, Tobias Wolffs, Paula Fox’ und Deborah Eisenbergs. Aber auch Jüngere wie Sherman Alexie, Junot Díaz, Sandra Cisneros, Nathan Englander und Lorrie Moore sind der Kurzgeschichte zugetan.
Südamerika kann mit Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga („Die Wildnis des Lebens“, 2010), Adolfo Bioy Casares, Felisberto Hernández („Die Frau, die mir gleicht“, 2006) und Julio Cortázar Kurzgeschichtenautoren des 20. Jahrhunderts von Weltrang vorweisen, die dem Genre neue Akzente verliehen.
Mit der Verleihung des Nobelpreises für Literatur an die kanadische Autorin Alice Munro im Jahr 2013 ist die Kurzgeschichte stark in den Fokus gerückt worden. Hat doch Munro ausschließlich Bände mit short stories veröffentlicht, zuletzt „Liebes Leben“ (2013). „Kurzprosa, Frauenliteratur, Provinzgeschichten: Die Kategorisierungen von Munros Stories, die meistens im Huron County im Südwesten Ontarios spielten, hatten immer etwas Verniedlichendes. Der Schriftstellerin, die auf Bildern rigoros herzerweichend lächelt, war das wohl ganz recht; im Schutzraum der Provinz und der Semi-Professionalität konnte sie an der Vollendung der Short Story arbeiten.“ (1)
Eigenschaften der Kurzgeschichte
Eben solches benötigt diese Gattung: Konzentration auf das Wesentliche, Pointiertheit, Zuspitzung und Präzision, geschliffen gezeichnete Charaktere, eine nicht selten auf Dialoge fokussierte Handlung. (2) So ist diese Gattung eine lesefreundliche, benötigt man doch in der Regel für eine Kurzgeschichte eine limitierte, überschaubare Lesezeit. Nicht ohne Hintersinn wählte der bulgarische Autor Dejan Enev für seinen Erzählband „Zirkus Bulgarien“ (2008) den Untertitel „Geschichten für eine Zigarettenlänge“.
Dieser begrenzte Textumfang hat in den letzten Jahren auch zu einer Renaissance der Kurzgeschichte geführt: in erster Linie im Internet und in Selfpublishing-Foren, aber auch bei deutschsprachigen Verlagen, die lange Zeit eher zögerlich Bände mit Kurzgeschichten publizierten.
Deutschsprachige Kurzgeschichten seit 1945
Das war im Zeitraum 1945 bis 1965 anders. Damals entsprach dieses einigermaßen schnell zu schreibende und rasch zu „konsumierende“ Genre den Umbrüchen der Zeit- und Gesellschaftsgeschichte. Namhafte deutsche Autorinnen und Autoren waren in Deutschland seit 1945 Heinrich Böll und Wolfdietrich Schnurre, Gabriele Wohmann, Hans Bender, Siegfried Lenz und Martin Walser, dessen literarisches Debüt ein Kurzgeschichtenband war („Ein Flugzeug über dem Haus“, 1955) sowie die heutzutage weniger bekannten Ingeborg Drewitz, Christa Reinig, Franz Fühmann und Kurt Kusenberg. (3)
Oft kippt die Kurz- und Kürzestgeschichte auch in Miniatur, Glosse und Kolumne, so beim Schweizer Peter Bichsel, dessen literarisches Hauptwerk der Band „Kolumnen, Kolumnen“ ist, (4) oder bei dessen Landsmann Kurt Marti.
Kurzgeschichten in und aus Österreich
Bemerkens- wie lesenswerte, oft kunstvoll konstruierte Kurzgeschichten legten österreichische Autorinnen und Autoren wie Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, Herbert Eisenreich und die 1942 ermordete Else Feldmann („Travestie der Liebe“, 2013) vor. Unter den Jüngeren sind als Auswahl zu nennen: René Freund („Stadt, Land und danke für das Boot“, 2013), Rudolf Habringer und Arno Geiger („Anna nicht vergessen“, 2007), Thomas Ballhausen, Bernhard Strobel und Monika Helfer („Die Bar im Freien“, 2012). Daniel Kehlmann nahm ein älteres Motiv, den sich zum Zyklus verschränkenden Geschichtenkranz, auf („Ruhm. Ein Roman in neun Geschichten“, 2009). Dies führte Margit Schreiner bereits 1995 mit dem Roman in Geschichten „Die Unterdrückung der Frau, die Virilität der Männer, der Katholizismus und der Dreck“ vor (Neuausgabe im Jahr 2004 – ohne den Untertitel – als „Die Eskimorolle“).
Auch österreichische Buchverlage entdecken die Form der Kurzprosa in jüngster Zeit wieder für sich. Weil sie zugleich ein Genre ist, das in seiner Knappheit den Lesegewohnheiten der nachwachsenden Generation der digital natives entspricht. So gibt es im Wiener Verlag edition atelier die Kurztextreihe „Textlicht“ mit Arbeiten von Ilir Ferra, Ulrike Schmitzer, Izy Kusche, Eva Schörkhuber und Claudia Tondl. (5) Die Tageszeitung „Der Standard“ initiierte 2013, auf ältere Zeitungstraditionen zurückgreifend, eine lose erscheinende Folge von Kurzgeschichten. Zu den bisher dort publizierten Autorinnen und Autoren gehören Clemens J. Setz und Peter Truschner, Josef Haslinger und Olga Grjasnowa sowie Margit Schreiner. Der Radiosender FM4 lobt seit einigen Jahren den Kurzgeschichtenwettbewerb „Wortlaut“ aus, dessen beste Beiträge auch in Buchform erscheinen. (6)
Anmerkungen
(1) Christian Buß: Wer lebt, der lügt. In: Spiegel Online, 5. Dezember 2013.
(2) Klaus Lubbers: Typologie der Kurzgeschichte. Darmstadt 1977; Manfred Durzak: Die Kunst der Kurzgeschichte. München 1989.
(3) Manfred Durzak: Die deutsche Kurzgeschichte der Gegenwart. 3., erw. Aufl. Würzburg 1992.
(4) Siehe die Selbstauskünfte Peter Bichsels in einem Gespräch mit der Berner Zeitung „Der Bund“, http://www.derbund.ch/bundprint/wirtschaft/story/21789701
(5) Siehe http://www.editionatelier.at
(6) Siehe http://fm4.orf.at/wortlaut