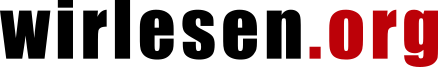Rund fünf Prozent der jährlichen Neuerscheinungen machen im deutschsprachigen Buchmarkt Bücher mit religiöser Thematik aus.
"Das 21. Jahrhundert wird ein Jahrhundert der Religion sein, oder es wird nicht sein". Diesen Satz des französischen Romanciers und Kulturpolitikers André Malraux wählte eine der Aufsehen erregendsten Neugründungen nach 2000, der Verlag der Weltreligionen, als seinen intellektuellen Startpunkt.
Im Herbst 2007 erschienen in diesem Ableger des angesehenen Suhrkamp Verlags die ersten Bücher. Die überwiegend wissenschaftlichen Veröffentlichungen, gefördert durch die Udo Keller Stiftung Forum Humanum, wenden sich allen Weltreligionen zu, Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus und Daoismus, Judentum, Christentum und Islam. Dies sowohl in der Gegenwart, bei lebenden Religionen, wie in der Historie. Unter den Veröffentlichungen finden sich auch Quellenwerke und Religionsschriften in neuer Übersetzung, die umfassend kommentiert sind.
Damit konkurriert im Segment religiöser Literatur dieser Verlag mit alteingesessenen Verlagen wie zum Beispiel Herder, Auer, Patmos, Benno, Don Bosco, Gerth Medien, dem Claudius Verlag, dem Gütersloher Verlagshaus, Kösel, Kreuz und der Evangelischen Verlagsanstalt.(1) Es gibt rund 50 katholische Verlage, ganz überwiegend in privatem Besitz, sowie ungefähr 80 katholische Buchhandlungen.(2) Der Verlag Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, zählt zu den 150 größten Verlagshäusern Deutschlands.
In den USA dominiert ein Verlag, Thomas Nelson, mit einem Anteil von knapp 50 Prozent den Markt religiöser Bücher. Dies dürfte auch der Grund gewesen sein, weshalb im Jahr 2011 der Buchkonzern HarperCollins, der zum globalen Medienimperium des Unternehmers Rupert Murdoch gehört, diesen Verlag aufkaufte. Ein weiterer Akquisegrund dürfte gewesen sein, sich durch ein derart marktbeherrschendes Verlagshaus von weitreichenden Forderungen des Internetversandhauses amazon unabhängig zu machen.(3)
Infolge des gesteigerten Interesses im deutschsprachigen Raum auf Grund der Bestellung eines deutschen Papstes Benedikt XIV. sowie dessen Nachfolgers, Papst Franziskus, mit dem nicht wenige in der katholischen Kirche Veränderung und Aufbruch assoziieren, haben Monografien, von ihnen oder über sie verfasst, in Deutschland und Österreich Bestsellerstatus erreicht. So betrug die Startauflage von Benedikts XIV. (Joseph Ratzinger) Monografie "Jesus. Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung" (2007) 400.000 Exemplare. Und das Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB) verzeichnet im September 2014 214 Einträge allein zum Stichwort "Papst Franziskus".
Bereits 1969 legten die Demoskopen Elisabeth Noelle-Neumann und Gerhard Schmidtchen im Verlag für Buchmarkt-Forschung einen 192-seitigen Bericht über "Religiöses Buch und christlicher Buchhandel" vor.
Genau 40 Jahre später präsentierte der Herder Verlag eine Publikation über ein durchgeführtes Seminar für im Buchhandel Tätige: "Religion und Religiösität. Ergebnisse des Religionsmonitors der Bertelsmann-Stiftung".(4) Demzufolge gibt es 123 religiöse Gemeinschaften mit rund 57 Millionen Mitgliedern. Den größten Anteil davon bilden die beiden christlichen Kirchen, die protestantisch-lutherische mit 31,3 Prozent und die römisch-katholische mit 30,7 Prozent. Eine fast ebenso große Gruppe (30,3 Prozent) bezeichnet sich selber als keiner Religion zugehörig. Aufschlussreich dabei: Von diesen sagen 50 Prozent von sich, über Religion und Religiöses nachzudenken und über diese Fragestellungen regelmäßig informiert zu werden. Es ordnen sich selber 2 Prozent als hochreligiös und 32 Prozent als religiös ein.
Am interessanten dabei mutet ein Vergleich der Antworten auf die Frage "Sind Sie ein religiöser Mensch an?", die 2007 in Deutschland das Allensbach-Institut im deutschen Allensbach am Bodensee stellte. Antworteten 2007 bei Allensbach 79 Prozent mit Nein, so waren es 2009 bei der Bertelsmann-Stiftung 49 Prozent. Wichtig auch die Ermittlung "Wie oft lesen Sie religiöse oder spirituelle Bücher?" Von allen Befragten gaben 4 Prozent an: sehr oft, 6 Prozent: oft, 16 Prozent: gelegentlich, 27 Prozent: selten, nie: 46 Prozent. Von jenen Befragten, die sich selber als hochreligiös einstufen, sagten 19 Prozent: sehr oft, 20 Prozent: oft, 29 Prozent: gelegentlich, 23 Prozent: selten. Der Anteil jener in diesem Segment, die nie zu religiöser oder spiritueller Literatur greifen, belief sich auf gerade einmal 8 Prozent.
Seit einigen Jahren wird jeden Monat das "Religiöse Buch des Monats" gekürt.(5)
Spiritualität
Der Drang zur Individualisierung innerhalb vor allem der westlichen Gesellschaften findet seinen Widerhall in einer Individualisierung des Verhältnisses zu Gott. Die Frage "Wie hältst du’s mit der Religion" wird heute von vielen anders beantwortet und oft persönlicher. Persönlicher deshalb, weil das Gottesbild kein einheitliches oder orthodoxes mehr ist. (Eine Gegenströmung hierzu sind fundamentalistische Strömungen im Christentum wie im Islam.) Vielmehr nehmen sich Menschen aus Religionen, aus den judäo-christlichen wie den asiatischen, was ihr und ihm gefällt oder gut tut und kreieren einen eigenen spirituellen Kosmos. Die Religionen sind heute, so der Münchner Soziologe Ulrich Beck, offen verfügbar. (6)
Spiritualität ist heute vielfältiger denn je. Sie bewegt sich zwischen der Institutionenkritik eines Karlheinz Deschner und dem Atheismus des englischen Naturwissenschaftlers Richard Dawkins, der 2007 mit dem Deschner-Preis ausgezeichnet wurde, und den vielen Publikationen des Weltethikers Hans Küng und der neuesten Welle eines Gegenwartshumanismus, den seit zehn Jahren Autoren wie Michael Schmidt-Salomon vertreten.(7)
Dieser, ein Erziehungswissenschaftler und Philosoph und 1998 Preisträger des Ethikpreises des Deutschen Allgemeinen Sonntagsblattes, meinte 1999 in seinem Beitrag zur Podiumsdiskussion "Projekt Weltethos? Religiöse und weltanschauliche Grundlagen der nachhaltigen Entwicklung" während der Trierer Agenda-Wochen so polemisch wie bewusst provokant: "Ist die Vernunft erst einmal mit dem religiösen Virus infiziert, so ist kein Mythos, keine Erzählung, kein Gedanke absurd genug, um nicht doch noch geglaubt zu werden." Er plädiert vielmehr für einen "Prozess weltweiter religiöser Abrüstung". Der in der Nähe von Trier lebende Publizist setzt beispielsweise den Zehn Geboten der großen christlichen Kirchen Zehn Angebote entgegen, in denen es jenseits aller Konfessionen unter anderem heißt: "Diene weder fremden noch heimischen ‚Göttern’, sondern dem großen Ideal der Ethik, das Leid in der Welt zu mindern!"; "Habe keine Angst vor Autoritäten, sondern den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!"; "Überwinde die Neigung zur Traditionsblindheit, indem du dich gründlich nach allen Seiten hin informierst, bevor du eine Entscheidung triffst!“(8)
Philosophie
Die Philosophie hingegen ist als Orientierungsfach weitgehend in den Hintergrund getreten. Sie tritt heute an Hochschulen und Universitäten zumeist als Geschichte der Philosophie auf. Auf dieses Segment haben sich Verlage wie Vittorio Klostermann (Frankfurt am Main), Felix Meiner (Hamburg) Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft (Berlin), Turia + Kant (Wien), Velbrück (Weilerswist), Vandenhoeck & Ruprecht (Göttingen) oder UTB, eine Kooperationsplattform von 15 Wissenschaftsverlagen, spezialisiert.
Bis auf wenige Namen wie Jürgen Habermas, Hans Blumenberg oder der in Wien lehrende Konrad Paul Liessmann sind Philosophen bei einer außeruniversitären und nicht-akademischen Leserschaft nur überschaubar präsent.
Ausnahmen von dieser Regel sind der in Karlsruhe lehrende, stetig publizierende Peter Sloterdijk, der zuletzt die Kulturanalyse "Die schrecklichen Kinder der Neuzeit" (2014) vorlegte, und Richard David Precht. Prechts "Wer bin ich – und wenn ja, wie viele? Eine philosophische Reise" (2007) ist bis heute ein großer Verkaufserfolg. Von Februar 2008 bis Oktober 2012 war es auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste notiert und hat sich, bis heute in 32 Sprachen übersetzt, mehr als eine Million Mal verkauft.
Anmerkungen:
(1) http://www.christliche-verlage.de
(2) http://www.dbk.de/katholische-kirche/katholische-kirche-deutschland/aufbau-ktah-kirche/kirche-und-medien/verlage-religioese-literatur/. Siehe auch: http://www.efg-hohenstaufenstr.de/downloads/texte/christliche_buchhandlungen.html
(3) http://www.buchmarkt.de/content/59004-beckmann-kommentiert.htm
(4) http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/religionsmonitor/
(5) http://www.borromaeusverein.de/auslese/ausgezeichnete-buecher/uebersicht-rel-buch/
(6) "Jeder kann seinen eigenen Gott erschaffen". Ulrich Beck im Gespräch über "Neue Religiosität", http://rundschau-hd.de/2008/09/jeder-kann-seinen-eigenen-gott-erschaffen-ulrich-beck-im-gesprach-uber-neue-religiositat/
(7) Michael Schmidt-Salomon: Manifest des Evolutionären Humanismus. Plädoyer für eine zeitgemässe Leitkultur, Alibri 2. korr. und erw. Aufl. 2006. Neueste Veröffentlichung: Hoffnung Mensch. Eine bessere Welt ist möglich, Piper 2014
(8) http://www.schmidt-salomon.de/reli_zukunft.htm