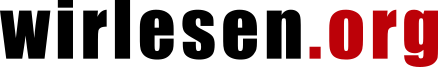Das digitale Zeitalter birgt Herausforderungen und Chancen für die heutige Gesellschaft. Dank des Internets gibt es neue und innovative Möglichkeiten, Inhalte zur Verfügung zu stellen, zu erstellen und zu verbreiten, auf neuen Wegen Werte zu schöpfen und durch die Förderung einer gut ausgebildeten Wissensgesellschaft die Voraussetzungen für Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand zu schaffen.
Die gegenwärtige Situation ist jedoch durch Unsicherheit geprägt. Um ein E-Book rechtsgültig online erwerben zu können, müssen VerbraucherInnen zunächst einen zehnseitigen Vertrag mit den Geschäftsbedingungen der Lizenz unterzeichnen. Verbraucherverbände verklagen E-Book-Verlage, und E-Book-Verlage wiederum verweigern den Verkauf von E-Books an Bibliotheken. Dabei werden viele Chancen verspielt!
Was wir brauchen, ist ein überarbeiteter und moderner urheberrechtlicher Rahmen! Ein solcher Rahmen würde diese Unsicherheiten beseitigen und gleichzeitig die wirksame Anerkennung und Vergütung von AutorInnen und sonstigen Rechteinhabern gewährleisten. Auch würde so der Zugriff auf E-Books für Benutzerinnen und Benutzer erweitert. Es würde BenutzerInnen die Möglichkeit gegeben, innerhalb des gesetzlichen Rahmens aus den durch Bibliotheken bereitgestellten E-Books Freude und persönlichen Gewinn zu schöpfen.
Vom Recht, elektronisch zu lesen
Die europäischen BürgerInnen haben das Recht, elektronisch zu lesen! Und es sollte ihnen die Möglichkeit gegeben sein, in Bibliotheken von diesem Recht Gebrauch zu machen. Daher sollte es Bibliotheken rechtlich erlaubt sein, E-Books zu verleihen. Bibliotheken gewährleisten freien Zugang zu Inhalten, zu Informationen und zu Kultur für alle europäischen BürgerInnen. Der gegenwärtig gültige rechtliche Rahmen verhindert es jedoch, dass Bibliotheken diesen wichtigen Auftrag zum Nutzen für unsere Gesellschaft im digitalen Zeitalter erfüllen können. Vor allem ist hier die Bereitstellung von E-Books betroffen.
Da die Vertriebsrechte nach dem Erstverkauf erschöpft sind, ist es Bibliotheken gestattet, veröffentlichte gedruckte Werke, z. B. Bücher, von einem Buchhändler zu kaufen und die Exemplare an BibliotheksnutzerInnen zu verleihen. Die Rechte der AutorInnen (oder anderer Rechtinhaber) werden hier nicht beeinträchtigt. Im Einklang mit ihren Richtlinien für die Bestandsentwicklung entscheidet die Bibliothek, welche Bücher erworben und an die Öffentlichkeit verliehen werden.
Verlage interpretieren das Urheberrecht dahingehend, dass die E-Ausleihe ein Dienstleistungsangebot ist, in dessen Zusammenhang das Erschöpfungsrecht nicht anwendbar ist. Sie sind der Meinung, dass die Rechteinhaber selbst entscheiden können, ob sie Zugang zu einem bestimmten Werk gewährleisten und welcher Art die Geschäftsbedingungen für einen solchen Zugang auszusehen haben. Sollte sich diese Auslegung des Urheberrechts durchsetzen, wäre die Folge, dass in erster Linie Verlage und nicht BibliothekarInnen über die digitalen Bestände in Bibliotheken entscheiden.
Dies ist eine bedeutende und unserer Ansicht nach inakzeptable Veränderung, dass die Richtlinien für die Bestandsentwicklung in Bibliotheken von Verlagen entschieden werden können. Bibliotheken wären in einem solchen Fall nicht mehr in der Lage sein, freien Zugang zu Inhalten, Informationen und Kultur für die europäischen BürgerInnen bereitzustellen.
Rechtliche Unsicherheit beenden
Im Juli 2012 entschied der Europäische Gerichtshof, dass das Erschöpfungsrecht hinsichtlich des Erwerbs von Software sowohl für das Herunterladen elektronischen Materials als auch für physische Datenträger gilt. Einige RechtsexpertInnen sind der Meinung, dass aufgrund dieses Beschlusses das Erschöpfungsprinzip auch für E-Books zu gelten habe. Mehrere Präzedenzfälle werden nun von den Gerichten untersucht. Es wird Jahre dauern, bis der Europäische Gerichtshof ein Urteil fällen wird.
Diese rechtliche Unsicherheit behindert Bibliotheken darin, attraktive E-Book-Services für die Öffentlichkeit bereitzustellen und darüber hinaus praktikable, gesetzlich erlaubte Angebote zum Nutzen aller Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln.
Das Recht auf Lesen muss auch ein Recht auf Lesen von E-Books sein. Dringend notwendig ist daher ein präzises Urheberrecht, welches den Bibliotheken erlaubt – wie bei gedruckten Büchern – uneingeschränkt E-Books zu kaufen, zu verleihen und dafür den AutorInnen eine angemessene Vergütung zu erstatten.