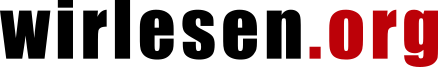1925 erschien mit "Männer der Technik" von Conrad Matschoß (1871-1942), der ab 1909 Jahrzehnte lang an der Technischen Hochschule Charlottenburg, später Technische Hochschule Berlin, als Dozent wirkte, ein laut Untertitel "biographisches Handbuch". Nach Matschoß ist auch ein Preis für Technikgeschichte benannt, der nach längerer Pause seit dem Jahr 2006 wieder verliehen wird.
Männer der Technik: Sinnfälliger hätte sein Buch nicht überschrieben sein können. Brachte der Hochschuldozent doch noch viele andere Bände heraus, allesamt über Ingenieure, die große Firmen gründeten, aus denen sich teils weltumspannende Firmen wie Bosch oder Siemens entwickelten. Matschoß’ erstes Buch hatte sich der Dampfmaschine gewidmet, sein letztes kreiste zu Beginn des Zweiten Weltkriegs um die Geschichte des Zahnrades.
Doch seit 1925 und seit Matschoß’ Darstellungen und Porträts hat sich im Lauf von fast 90 Jahren das Gebiet der Technik und der Technikgeschichte in Buchform derart verändert und eine Erweiterung der Aspekte und Darstellungsarten erfahren wie kaum ein anderes Feld im Sachbuchsegment.
"Technikgeschichte ist … keine Geschichte von Erfindern oder von Artefakten, und auch keine Geschichte der Rekonstruktion technischer Entwicklungen. Vielmehr beschreibt und analysiert sie die Entstehung, Verbreitung und Nutzung von Technik, kurz technischen Wandel und dessen Wechselwirkung mit der Gesellschaft."(1) So die jüngste Beschreibung dieses Gebiets aus der Feder der an einer Hamburger Universität lehrenden Professorin für Neuere Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte Martina Heßler.
Der früher sehr enge, rein technizistische und auf einzelne "große" Persönlichkeiten, durchweg Männer, fokussierte Zugang zu Technik und die Ausrichtung auf die geschichtliche Entwicklung und progressive Verbesserung der technischen Umwelt haben sich im Lauf der Jahre umfassend erweitert.
Das soziale Umfeld der Technisierung wird inzwischen ebenso breit berücksichtigt wie die damit einhergehende, nicht selten hinterherhinkende Industrialisierung des Bewusstseins. Die Erzählungen über Forschungen und Innovationen werden eingebettet in kulturelle, politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Veränderungen.(2)
Auch bei Einzeldarstellungen eminenter Wissenschaftler wird nicht mehr aus einer heroisierenden Verehrungsperspektive geschrieben, vielmehr Charakter, Wirkung und Vorgehen, von Konrad Lorenz und Otto Koenig bis zu Physikern wie Niels Bohr und J. Robert Oppenheimer, facettenreich ausgeleuchtet und bewertet.(3)
Vor allem im letzten Vierteljahrhundert des 20. Jahrhunderts, seit dem Siegeszug des Computers und der seither immer schneller und immer atemloser voranschreitenden Digitalisierung des Alltagslebens und der Revolutionierung von Kommunikation und Lebensstil, Stichwort: Internet, hat die technologische Kultur so stark wie niemals zuvor die Welt verändert.
Die "Herrschaft der Mechanisierung", so der Titel einer seit seiner Erstveröffentlichung 1948 mehrfach neu aufgelegten Monographie des Schweizer Technikhistorikers Sigfried Giedion, und der "Mythos der Maschine", wie der US-Amerikaner Lewis Mumford 1964 sein einflussreiches Buch nannte, haben inzwischen ganz andere Formen angenommen.(4)
Diese führen das Phänomen der Technik in all ihrer zeitgenössischen Komplexität vor und gehen darin weit über die klassischen kulturkritischen Untersuchungen des 20. Jahrhunderts von Philosophen wie Günter Anders, Theodor W. Adorno oder Martin Heidegger hinaus. Sie thematisieren angesichts der Rasanz voranschreitender Technologien die Vielgestaltigkeit und die daraus entstehenden wechselseitigen Abhängigkeiten von Benutzer und benutzter Technik, von Gewohnheit und Aneignung wie von kreativer Zerstörung und destruktiven Möglichkeiten.(5) So wächst Technikgeschichte ein ungewöhnlich großes Potenzial an Möglichkeiten zu, aber zugleich ebenfalls eine ungeahnte politische Sprengkraft.
So geht es in Büchern aus diesem Segment einerseits um internationale und globale Zukunftsszenarien aus dem Silicon Valley. Diese Einflüsse sollen das Leben ebenso zu transformieren in der Lage sein wie der Einsatz von Nanotechnologie, deren Befürworter damit Krankheiten lindern und heilen möchten, während andere auf unberechenbare Risiken verweisen.(6)
Andererseits werden aber heutzutage auch kleinere Mikrokosmen und überraschende Zusammenhänge untersucht, etwa User-Design und Konsumverhalten, Alltagspraktiken und Herrschafts- wie Geschlechterverhältnisse.(7)
Innen und Außen, Kosmos, Licht, Zeit
Viele Physiker richten ihren Blick gleich ins All und schildern die Geschichte des Universums(8) oder erläutern auf allgemeinverständliche Art außergewöhnliche Theorien über Superstrings und Paralleluniversen.(9)
Manche bleiben hingegen auf dem Boden. So der Münchner Zoologe Josef H. Reichholf, der in den vergangenen 25 Jahren zwei Dutzend Bücher über Fauna und Flora und Ökologie veröffentlicht hat, zuletzt mit "Ornis" ein Buch über Vögel.(10) Andere widmen sich der Erde, ihren Elementen und deren Bedrohungen.(11)
Ganz ins Innere des menschlichen Körpers führen aktuelle Forschungen, bei denen sich Biologie, Chemie und Physik miteinander verquicken. Im Zuge dessen sind diese Fächer in jüngster Zeit kritischer denn je begleitet worden. So ist etwa die Biochemie im Zuge philosophischer, juristischer wie ethisch-moralischer Argumentationen um Genetik, pränatale Diagnostik und die Verquickung von akademischer Forschung mit privatwirtschaftlichen Interessen in den Fokus einer breiten politischen und gesellschaftlichen Debatte gerückt.
Ganz Ähnliches gilt auch für die Nahrungsmittelchemie und etwa den umstrittenen Anbau und Verzehr genetisch modifizierter Lebensmittel und deren langfristiger Folgen für den Menschen, aber ebenso auch um die ethischen und religiösen Grenzen biochemischer Forschung, Stichwort: Klonen.(12)
Über die Welt gebeugt
Am Ende steht im naturwissenschaftlichen Sachbuchsektor präzise stets und allgegenwärtig eines: die präzise "Berechnung der Welt", wie Klaus Mainzer sein jüngstes Buch treffend überschrieb. Und das, was der Konstanzer Wissenschaftshistoriker Ernst Peter Fischer für sich trotz wissenschaftlicher Seriosität zur Leitprämisse erhoben hat: das unablässige Staunen über die Welt.(13)
Was ihn verbindet mit dem vielleicht größten Ahnherrn der neuzeitlichen Botanik, mit dem von Victor Hugo als "Homer der Insekten" bezeichneten Franzosen Jean-Henri Fabre (1823-1915).
Dessen "Erinnerungen eines Insektenforschers" erscheinen derzeit erstmals vollständig in einer neuen Übertragung. Die auf zehn Bände angelegten Edition (bis 2014 sind sechs erschienen) wird illustriert vom Zeichner Christian Thannhauser aus Ottensheim an der Donau. In einer von Fabres intensiven, noch immer packenden Schilderung trat er selber auf: auf den Knien liegend vor einem Thymianbusch, eine Lupe in der Hand, einen alten Filzhut auf dem Kopf, gebannt von den Vorgängen, die sich vor ihm abspielen – einer kleinen Sandwespe auf Beutejagd.(14)
Anmerkungen
(1) Martina Heßler: Kulturgeschichte der Technik, Frankfurt am Main und New York 2012, S. 8
(2) George Dyson: Turings Kathedrale. Die Ursprünge des digitalen Zeitalers, Berlin 2014; Richard von Schirach: Die Nacht der Physiker, Berlin 2012
(3) Benedikt Föger und Klaus Taschwer: Die andere Seite des Spiegels. Konrad Lorenz und der Nationalsozialismus, Wien 2001; Leopold Lukschanderl: Otto Koenig. Der Tierprofessor vom Wilhelminenberg, Wien 2014.
Ernst Peter Fischer: Niels Bohr, München 2012; Kai Bird und Martin J. Sherwin: J. Robert Oppenheimer, Berlin 2009
(4) Sigfried Giedion: Mechanization Takes Comannd, New York 1948, deutsche Ausgabe: Die Herrschaft der Mechanisierung. Ein Betrag zur anonymen Geschichte, Frankfurt am Main 1982; Lewis Mumford: The Myth of the Machine, New York 1964; deutsche Ausgabe: Mythos der Maschine, Zürich 1974
(5) Nicholas Carr: Abgehängt. Wo bleibt der Mensch, wenn der Computer entscheidet? München 2014
(6) Christoph Keese: Silicon Valley. Was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt, München 2014; Christian Meier: Nano. Wie winzige Technik unser Leben verändert, Darmstadt 2014
(7) Andrew Pickering: Kybernetik und Neue Ontologien, Berlin 2007; Bruno Latour: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Gesellschaft, Frankfurt am Main 2007
(8) Lee Smolin: Im Universum der Zeit. Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis des Kosmos. , München 2014; Ben Moore: Da draußen. Leben auf unserem Planeten und anderswo, Zürich 2014
(9) Brian Greene: Das elegante Universum. Superstrings, verborgene Dimensionen und die Suche nach der Weltformel, Berlin 2000
(10) Josef H. Reichholf: Ornis. Das Leben der Vögel, München 2014
(11) Maude Barlow: Blaue Zukunft, München 2014; Gerald H. Pollack: Wasser – viel mehr als H20, Kirchzarten 2014
(12) Jens Kersten: Das Klonen von Menschen. Eine verfassungs-, europa- und völkerrechtliche Kritik, Tübingen 2004
(13) Klaus Mainzer: Die Berechnung der Welt. Von der Weltformel bis Big Data, München 2014; Ernst Peter Fischer: Die Verzauberung der Welt. Eine andere Geschichte der Naturwissenschaften, München 2014
(14) Jean-Henri Fabre: Erinnerungen eines Insektenforschers, Berlin 2009-2014