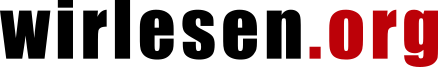PISA (Programme for International Student Assessment) wurde in den Jahren 1996/97 von der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) ins Leben gerufen, um die Effektivität der Schulsysteme in den Mitgliedsstaaten zu erheben. Die bei PISA gewonnenen Daten dienen den Bildungsverantwortlichen in den Teilnehmerländern als Basis für Steuerungsentscheidungen. Die zentrale Fragestellung von PISA ist dabei, wie gut es den unterschiedlichen Schulsystemen gelingt, die SchülerInnen auf die Herausforderungen der Zukunft und das „lebenslange Lernen“ vorzubereiten.
PISA: Ziele und Inhalte
Um dies festzustellen, werden die Kompetenzen der SchülerInnen im Alter von 15/16 Jahren – das entspricht in den meisten Ländern dem Ende der Pflichtschulzeit – alle drei Jahre in drei zentralen Bereichen gemessen: Lesen, Mathematik und Naturwissenschaft. Die PISA-Aufgaben erfassen, inwieweit SchülerInnen in der Lage sind, alltagsrelevante Probleme effektiv zu lösen, ihre Lösungen zu begründen und darzulegen. Zusätzlich zu den Tests beantworten die Jugendlichen einen Fragebogen zu wichtigen Hintergrundmerkmalen, die in Zusammenhang mit den gemessenen Leistungen stehen, wie z. B. zu Geschlecht, Beruf und Ausbildung der Eltern, Geburtsland und Muttersprache der SchülerInnen, aber auch Fragen zu Einstellungen, Motivation und Unterricht. Auch für SchulleiterInnen gibt es einen Fragebogen zu wichtigen Einflussfaktoren auf Schulebene (z. B. Schul- und Unterrichtsressourcen, Angebote für SchülerInnen, Managementaufgaben der Schulleitung etc.).
Im Mittelpunkt von PISA 2012 stand die Mathematikkompetenz der Jugendlichen. Die Lesekompetenz wurde – so wie die Naturwissenschaftskompetenz – mit je ca. einem Viertel der Aufgaben als Nebendomäne erfasst. Lesen wurde bei PISA 2009 und 2000 schwerpunktmäßig erfasst.
Weltweit absolvierten im Jahr 2012 rund 480.000 SchülerInnen in 65 Ländern (34 OECD- und 31 Partnerländer) den PISA-Test. In Österreich wurden 4755 zufällig ausgewählte SchülerInnen des Jahrgangs 1996 in einer repräsentativen Stichprobe aus 191 Schulen aller Schultypen getestet.
Lesekompetenz im Vergleich
Lesekompetenz wird bei PISA folgendermaßen definiert: „Lesefähigkeit bedeutet, geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen, über sie zu reflektieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.“ (1)
Lesekompetenz dient demnach als Grundlage für den Erwerb von Wissen und für eine erfolgreiche Teilhabe an der Gesellschaft – ganz im Sinne des lebenslangen Lernens. Bei den Leseaufgaben steht das sinnerfassende Lesen im Vordergrund: Die SchülerInnen müssen zeigen, dass sie Informationen in einem Text auffinden können, einen Text als Ganzes verstehen und über dessen Inhalt und/oder dessen Form reflektieren können.
Österreichs SchülerInnen erzielen bei PISA 2012 in Lesen einen Mittelwert von 490 Punkten und liegen damit knapp, aber signifikant unter dem OECD-Durchschnitt von 496. In 12 Ländern erreichen die Jugendlichen ähnliche Leseleistungen wie in Österreich, darunter die drei Nachbarländer die Tschechische Republik (493 Punkte), Italien (490 Punkte) und Ungarn (488 Punkte). SchülerInnen in Deutschland (508 Punkte) und der Schweiz (509 Punkte) zeigen im Schnitt signifikant bessere Leistungen als Österreichs 15-/16-Jährige.
Die besten Leseleistungen innerhalb der OECD erbringen Jugendliche in Japan (538 Punkte) und Korea (536 Punkte). Finnland liegt als bestes europäisches Land mit einem Mittelwert von 524 Punkten an dritter Stelle.
In Österreich zeigt sich bei PISA 2012 in Lesen eine starke Verbesserung um 20 Punkte gegenüber PISA 2009, womit die Ergebnisse wieder ähnlich sind wie in den Erhebungsjahren zuvor.
Die drei Leseprozesse
Für die Erhebungsjahre, in denen Lesen schwerpunktmäßig (mit ca. der Hälfte der Aufgaben) erfasst wurde (PISA 2009 und 2000), können drei zentrale Leseprozesse analysiert werden: So zeigen Österreichs SchülerInnen bei PISA 2009 beim „Ermitteln von Informationen“ (477 Punkte) eine relative Stärke. Beim „Kombinieren und Interpretieren“ (471 Punkte) – die SchülerInnen müssen dabei zeigen, dass sie den Text als Ganzes verstehen und eine einfache Interpretation vornehmen – sind die Leistungen etwas geringer. Eine besondere Schwachstelle in Lesen zeigt sich bei PISA 2009 beim „Reflektieren und Bewerten“ von Inhalten oder der Struktur eines Textes (463 Punkte). Von PISA 2000 auf 2009 gingen die Österreich-Ergebnisse bei allen drei Leseprozessen deutlich zurück, wobei die Veränderungen von unterschiedlicher Stärke sind. Besonders groß war der Leistungsrückgang beim „Reflektieren und Bewerten“ (–33 Punkte), gefolgt vom „Interpretieren“ (–22 Punkte). Hingegen war der Rückgang beim „Ermitteln von Informationen“ mit –10 Punkten eher gering, womit die österreichischen Jugendlichen 2009 bei diesem Prozess am leistungsstärksten sind.
Spitzen- und RisikoschülerInnen
Zusätzlich zur Darstellung der Mittelwerte ist es bei PISA möglich, SchülerInnen auf Basis ihrer Testergebnisse bestimmten Kompetenzstufen zuzuordnen, die inhaltlich durch die entsprechenden Aufgaben beschrieben werden. In Lesen werden seit PISA 2009 sieben Kompetenzstufen unterschieden (Stufe 1b, 1a, 2, 3, 4, 5, 6). SchülerInnen auf den höchsten Stufen 5 und 6 sind in der Lage, mehrfache Schlussfolgerungen zu ziehen, detaillierte und präzise Vergleiche anzustellen und Gegensätze zu erfassen. Sie werden zur „Spitzengruppe“ in Lesen zusammengefasst. SchülerInnen auf den untersten Stufen 1a und 1b können hingegen nur die einfachsten Aufgaben lösen, wie zum Beispiel eine oder mehrere voneinander unabhängige Informationen aus einem einfachen Text in vertrautem Kontext heraussuchen.
SchülerInnen, die auch diese einfachsten Aufgaben nicht mehrheitlich lösen können, befinden sich unter Level 1b. Gemeinsam mit jenen der Stufen 1b und 1a bilden sie die Lese-Risikogruppe. Diese RisikoschülerInnen können gegen Ende der Pflichtschulzeit nur unzureichend sinnerfassend lesen und laufen dadurch Gefahr, in ihrem privaten und gesellschaftlichen Leben sowie beim selbstständigen Bildungserwerb erheblich beeinträchtigt zu werden. Auch der Eintritt in den Arbeitsmarkt könnte für diese SchülerInnen schwierig werden.
In Österreich gehören 20 Prozent der SchülerInnen am Ende der Pflichtschulzeit zur Lese-Risikogruppe. Das bedeutet, dass eine/r von fünf Jugendlichen einfache Leseaufgaben nicht routinemäßig lösen kann. Im OECD-Schnitt gehören 18 Prozent der 15-/16-Jährigen zur Lese-Risikogruppe. Die kleinsten Lese-Risikogruppen gibt es in Korea (8 Prozent), Estland (9 Prozent), Irland (9 Prozent) und Japan (10 Prozent). Im Vergleich zu vorhergehenden PISA-Ergebnissen ist die Größe der Lese-Risikogruppe in Österreich mit der Ausnahme von PISA 2009 (28 Prozent) relativ konstant geblieben (Minimum 19 Prozent bei PISA 2000, Maximum 21 Prozent bei PISA 2003 und 2006 bzw. 28 Prozent bei PISA 2009).
Rund 6 Prozent der österreichischen 15-/16-Jährigen zählen am Ende der Pflichtschulzeit zur Lese-Spitzengruppe. Dies ist etwas weniger als im OECD-Schnitt (8 Prozent). Mit knapp 9 Prozent weisen die Nachbarländer Schweiz und Deutschland etwas größere Spitzengruppen als Österreich auf. Alle anderen Nachbarländer liegen etwa im Bereich von Österreich. Die größte Lese-Spitzengruppe verzeichnet Japan mit 19 Prozent. Gegenüber PISA 2009 (5 Prozent) ist das österreichische Ergebnis nahezu unverändert, von PISA 2000 (7 Prozent) bis 2006 (9 Prozent) sind kleine Zuwächse zu verzeichnen.
Weitere Leseergebnisse auf einen Blick
Mädchen schneiden in allen OECD-Ländern bei allen bisherigen PISA-Erhebungen beim Lesen deutlich besser ab als Burschen und haben auch einen geringeren Anteil an RisikoschülerInnen.
PISA 2009 zeigte eine eher geringe Lesemotivation der österreichischen Jugendlichen: Gut die Hälfte der SchülerInnen gibt an, nie zum Vergnügen zu lesen. Vergleicht man die Lesedauer verschiedener Lesemedien, kristallisieren sich Zeitungen und Zeitschriften sowie Lesen von E-Mails oder Online-Nachrichten, Chatten sowie Suchen nach Informationen im Internet als bevorzugte Leseaktivitäten heraus.
Der Zusammenhang der Leseleistungen mit dem familiären Hintergrund der SchülerInnen ist zu allen Erhebungszeitpunkten deutlich erkennbar. Österreich gehört hierbei zu jenen Ländern, in denen dieser besonders stark ausgeprägt ist.
Anmerkungen:
(1) OECD, 2013, S. 61; Übersetzung: BIFIE