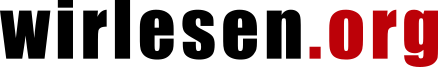Am Ende des 20. Jahrhunderts etablierte sich der Kriminalroman endgültig in den Programmen anspruchsvoller literarischer Verlage des deutschsprachigen Raums, nicht nur im Zürcher Haus Diogenes, der bis dahin etwa Patricia Highsmith und Friedrich Dürrenmatt betreut hatte. Denn im Jahr 1998 brachte der Wiener Paul Zsolnay Verlag, Teil der Gruppe des renommierten Münchner Literaturverlags Carl Hanser, Henning Mankells Roman „Die fünfte Frau“ heraus. Es war der Beginn der Welle so genannter Schwedenkrimis.
Der große Erfolg lässt sich auf die Mischung dramaturgisch gekonnt eingesetzter Spannungselemente und psychologisch grundierter Gesellschaftskritik zurückführen, eine Mélange, die eine Generation zuvor schon für die zehnbändige Kommissar Beck-Reihe (1965–1975) von Per Wahlöö und Maj Sjöwall galt. Kurz vor der Jahrtausendwende war die Zeit reif für eine umfassende Durchsetzung des bis dahin noch immer als trivial angesehenen Spannungssegments – die ersten zwei Wallander-Krimis waren noch Anfang der 1990er Jahre gänzlich unbemerkt in einem Berliner Kleinverlag erschienen.
Erfolgreiche schwedische Nachfolger des Zyklus sind, abgesehen von Stieg Larsson, der von der auf zehn Bände projektierten „Millenium“-Reihe nur drei fertig stellen konnte, die zu globalen Bestsellern avancierten, die Autorinnen Camilla Läckberg, Vivica Sten, Åsa Larsson und Liza Marklund sowie Håkan Nesser, Arne Dahl, jüngst Lars Kepler und das Duo Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt.
Andere nordische Autoren landen mit ihren Bänden regelmäßig auf den vordersten Plätzen der Bestsellerlisten: der Norweger Jo Nesbø mit der Harry Hole-Reihe sowie der Däne Jussi Adler-Olsen mit seinen Romanen um Kommissar Carl Mørck.
Internationale Tendenzen
Auch andere renommierte Literaturverlage haben das Segment des Kriminalromans als wichtigen Wirtschaftsfaktor entdeckt, so etwa der Suhrkamp Verlag, dessen erfolgreichster Autor der letzten Jahre Don Winslow mit seinen im südkalifornischen Surfer- und Drogenmafiamilieu spielenden Büchern gewesen ist.
Mittlerweile ist das Spektrum an Kriminal- und Spannungsromanen thematisch, stilistisch und das Ausmaß an Gewaltschilderungen betreffend sehr breit gefächert. Es reicht von Neo-Noir Crime (Ken Bruen, Warren Ellis) bis zu Retro-Krimis à la Agatha Christie und Arthur Conan Doyle (Alexander McCall Smith, Jacqueline Winspear, Anthony Horowitz), manchmal ergänzt durch nuancierte Psychologie (Ruth Rendell, die auch als „Barbara Vine“ veröffentlicht, Val McDermid, Elizabeth George). Es gibt Kriminalromane, in denen Tiere Ermittlerrollen übernehmen, von Katzen und Schweinen bis zu Schafen und einer Wanze (Paul Shipton, „Die Wanze. Ein Insektenkrimi“, 2000). Es gibt Spannungsromane, die in der jüngeren Zeithistorie angesiedelt sind (Philipp Kerrs „Bernard-Gunther“-Serie und Volker Kutschers Bücher um Kommissar Gereon Rath, beide in den 1930er und 1940er Jahren in Berlin situiert), Spannungsromane in der Nachfolge des Katalanen Manuel Vázquez Montálban (1939–2003), in deren Mittelpunkt gastronomische Genüsse stehen (Tom Hillenbrand, Carsten Sebastian Henn), sowie Thriller, die gesellschaftliche Missstände aufgreifen (John Le Carré, „Der ewige Gärtner“, 2001). Letzteres ist, betrachtet man die Romane Dominique Manottis und des Autors mit dem Pseudonym DOA, eine französische Spezialität (Dominique Manotti/DOA, „Die ehrenwerte Gesellschaft“, 2012). (1)
Neue Punkte auf der Mörder-Landkarte
Auf der literaturkriminalistischen Landkarte sind seit den 1990er Jahren Länder und Regionen aufgetaucht, die bis dato diesbezüglich recht unverdächtig waren.
Ian Rankin löste mit seinen in Edinburgh angesiedelten Büchern um Inspector John Rebus ein Interesse für Schottland aus. Spannungsbücher seiner Landsleute Tony Black, Denise Mina und Christopher Brookmyre sind mittlerweile auch auf Deutsch erfolgreich.
Bruce McGilloway, vor allem Adrian McKinty („Der katholische Bulle“, 2013) und Sam Millar („Die Bestie von Belfast“, 2013) präsentieren Nordirland als Handlungsort, Roger Smith und Deon Meyer siedeln ihre Bücher in ihrer Heimat Südafrika an. Der Berliner Kritiker Thomas Wörtche verantwortete von 1999 bis 2007 im Schweizer Unionsverlag die Reihe „metro“, die sich Kriminalistischem aus exotischen Regionen annahm, beispielsweise aus Istanbul, Angola, Kuba, Hongkong, Las Vegas oder Vietnam (seit 2013 gibt Wörtche die Krimireihe „Penser Pulp“ im Diaphanes Verlag heraus). (2)
Für Thriller aus den USA sind zwei größere Strömungen auszumachen.
Einerseits gibt es Autoren, die in Spannungsromanen Konspirationen zumeist globalen Maßstabes schildern und diese von US-Elitesoldaten oder Angehörigen der Geheimdienste erfolgreich abschmettern lassen (Tom Clancy, Brad Meltzer, Matthew Reilly, David Baldacci; Lee Child und das Duo Douglas Preston und Lincoln Child variieren in ihren Romanen mit Aloysius Pendergast beziehungsweise Jack Reacher das Muster teils ironisch unterfüttert).
Zum anderen haben sich Autorinnen und Autoren dem Genre des Polizeiromans zugewandt und, nach den revierorientierten Büchern Ed McBains, gebrochene Charaktere eingeführt, die in unterschiedlichen Milieus und Regionen ermitteln, zwischen Los Angeles (Michael Connellys Harry Bosch), Minnesota (John Sandfords Lucas Davenport und Virgil Flowers), Louisiana (James Lee Burkes David Robicheaux) und New York (Jeffery Deaver und seine Hauptfiguren Lincoln Rhyme, der vom Hals abwärts gelähmt ist, und Amelia Sachs).
Regionalisierung
Ein seit einigen Jahren immer stärkerer Trend innerhalb der deutschsprachigen Kriminalliteratur ist die Regionalisierung (inzwischen haben deutschsprachige Fernsehanstalten mit mehreren Serien nachgezogen).
So gibt es in Deutschland zwischen dem Schwarzwald und Sylt, zwischen dem Allgäu und der Ostsee keine Region und kaum eine größere Stadt, in denen kein Kriminalroman oder eine ganze Serie angesiedelt ist. Mehrere regional ausgerichtete Verlage bedienen erfolgreich dieses Segment, beispielsweise Gmeiner in Meßkirch, oder Emons in Köln. (3)
Gleiches gilt, in kleinerem Maßstab, für die Schweiz. Viel stärker aber, dank Verlagen wie Haymon in Innsbruck oder Folio und Czernin in Wien, für Österreich.
Städte und Regionen wie das Mühlviertel (Friedrich Karl Altmann), Kitzbühel (Georg Haderer), Graz (Robert Preis), Altaussee (Herbert Dutzler) oder ausgewählte Grätzel der Bundeshauptstadt in Gegenwart (u. a. Eva Rossmann, Manfred Rebhandl, Christian David und Stefan Slupetzky) und Vergangenheit (Gerhard Loibelsberger, Edith Kneifl) sind kriminalistisch ausgeleuchtet worden. Alle Bundesländer, vom Burgenland (Beate Lessler-Raute) bis Salzburg (Ursula Poznanski), Tirol (Bernhard Aichner) und Vorarlberg (Christian Mähr, Kurt Bracharz) sind kriminalliterarisch inzwischen aktenkundig.
Eine Besonderheit des österreichischen Kriminalromans ist dabei der gängige Genrekonventionen sprengende kunstvoll literarische Umgang mit Sprache, so etwa bei Heinrich Steinfest (4), Thomas Raab, Wolf Haas, Manfred Rebhandl und Alfred Komarek, (5) weswegen der österreichische Kriminalroman medial gern als „schräg“ eingestuft wird. (6)
Anmerkungen:
(1) Thomas Wörtche: Das Mörderische neben dem Leben. Ein Wegbegleiter durch die Welt der Kriminallliteratur, Libelle Verlag, Lengwil 2008; Klaus-Peter Walter (Hg.): Reclams Krimi-Lexikon. Autoren und Werke. Stuttgart 2002; Jochen Schmidt: Gangster, Opfer, Detektive. Eine Typengeschichte des Kriminalromans. Berlin 1989.
(2) Diaphanes Verlag
(3) Alexander Kluy: Schlachtplatte nach Bauernart. Mord vor der eigenen Haustür: Der literarische Nervenkitzel aus der Provinz boomt. In: Rheinischer Merkur (Bonn), 15. Februar 2007.
(4) Alexander Kluy: Schräge Wunder. Der Krimiautor Heinrich Steinfest im Porträt. In: Buchkultur, H. 113, 2007.
(5) Michael Rohrwasser: Schwermütige Detektive. Der österreichische Kriminalroman ist mittlerweile ein eigenständiges Genre, das sich von den Krimis anderer Länder markant unterscheidet. In: Wiener Zeitung, 17. August 2007.
(6) Alexander Kluy: Im detektivischen Halbschlaf. Ausgefallene, schräge Kriminalromane: In kaum einem anderen Genre wird derzeit so wild-wundersam experimentiert, geschüttelt und gerührt. In: Bücherpick (Zürich), Herbst-Heft, 22. Oktober 2009.