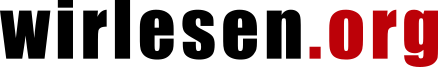Als Michael Krüger, langjähriger Leiter des belletristischen Carl Hanser Verlags in München und selbst namhafter Lyriker (1), Mitte Jänner 2014 im Schloss Bellevue zu Berlin vom deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck das Verdienstkreuz Erster Klasse verliehen wurde, machte er in seiner Dankesrede einen ungewöhnlichen Vorschlag.
Keine gute Zeit
Einen Vorschlag, den man von ihm bereits andernorts gehört hatte. Nämlich, eine jede Sitzung des Deutschen Bundestags mit der Lesung eines Gedichtes zu beginnen. „Stellen Sie sich vor“, so Krüger, „Pofalla (2) liest zu Beginn ein kurzes Gedicht von Celan. Ich sage Ihnen: die ganze Sprachform der Sitzung würde sich ändern.“
Würden dann auch gute Zeiten anbrechen für das Genre Lyrik? Gedichte schließlich werden immer noch geschrieben und Dichter wie Tomas Tranströmer mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Sie spielen jedoch heutzutage im Buchhandel wie auch in den Büchereien nur noch eine randständige Rolle.
Schon vor vierzig Jahre hatte der 1971 von Ost- nach Westdeutschland übersiedelte Dichter Peter Huchel (1903 bis 1981) in einem Zeitungsinterview auf die Frage, ob denn die Gegenwart keine gute Zeit für Lyrik sei, resigniert geantwortet: Nein, keine gute Zeit für Lyrik.
Festivals und Einrichtungen
Doch damals gab es noch nicht die spezifische Förderung durch Institutionen und mittels Auszeichnungen sowie zahlreiche Auftrittsmöglichkeiten bei Festivals.
So wird seit 1983, verliehen und gestiftet vom deutschen Bundesland Baden-Württemberg und dem Südwestrundfunk, der mit 10.000 Euro dotierte Peter-Huchel-Preis verliehen: an Autorinnen und Autoren, deren eindeutiger Schreibschwerpunkt die Lyrik ist. 2014 erhielt den Preis der Berliner Steffen Popp zugesprochen, in den Jahren zuvor wurden Monika Rinck und Nora Bossong geehrt. In der Liste der Ausgezeichneten finden sich Friederike Mayröcker (2010), der Südtiroler Oswald Egger (2007), Raoul Schrott (1999) und Ernst Jandl (1990). (3) Seit 1979 wird der Leonce-und-Lena-Preis vergeben, der ebenso wie der Lyrikpreis Meran (4) von einer Jury aus eingesandten Arbeiten ausgesucht wird.
Die Schweiz verfügt über mehrere, sich auf Lyrik konzentrierende Veranstaltungen, so das Internationale Lyrikfestival in Basel, (5) die Frauenfelder Lyriktage und den Seetaler Poesiesommer auf Schloss Heidegg in Gelfingen, Kanton Luzern, der bewusst vielsprachig konzipiert ist, etwa mit Homer-Rezitationen auf Schwedisch oder einer Lesung aus Werken William Shakespeares, übertragen in Nidwaldner Dialekt. (6)
In Deutschland wird seit 1980 im fränkischen Erlangen nahe Nürnberg das Erlanger Poetenfest abgehalten. Auch bei anderen Literaturfestivals in Deutschland nimmt die Poesie großen Raum ein, so bei den Tagen der Poesie in Würselen, beim Hausacher Leselenz, auf dem Internationalen Literaturfestival Berlin und beim Internationalen Literaturfestival „Poetische Quellen“ im Kurort Bad Oeynhausen. 2012 wurde mit dem Schamrock-Festival das erste internationale Festival der Dichterinnen in München abgehalten.
Eine ständige Einrichtung ist das Lyrik-Kabinett in München mit regelmäßigen Lesungen, der Diskussionsrunde „Das lyrische Quartett“ und einer Spezialbibliothek. (7) Diese sich einer Stiftung verdankende Institution kooperiert auch mit dem Internationalen Poesiefilmfest München sowie mit dem Münchner Carl Hanser Verlag bei einer Lyrikreihe, in der unter anderen Raoul Schrott aus Landeck seine poetisch-archäologischen Übersetzungs- und Findungskünste einsetzte. (8) Derzeit arbeitet der Tiroler an einem Versepos mit dem Titel „Die erste Erde“, denn, so der Autor in einem Gespräch: „Nur die Poesie kann die Geschichte der Welt erzählen.“
Formal ist die Gegenwartspoesie überaus reichhaltig und vielgestaltig. Sie reicht vom Haiku bis zum Langgedicht, das etwa Jürgen Becker und jüngst Oswald Egger in deutscher Sprache wieder belebt haben. Das Internet bietet inzwischen auf Grund vieler der Poesie gewidmeten Websites einen leichten Zugang zu einer großen Auswahl. So finden sich auf www.lyrikwelt.de, in der Zeitschrift „Das Gedicht“ oder auf der Website der Berliner Literaturwerkstatt www.literaturwerkstatt.org eine große Zahl an Gedichten, Arbeits- und Textproben.
Lyrik in und aus Österreich
Merkwürdigerweise fehlt in Druckform ein repräsentatives, auch jüngste Tendenzen umfassendes Lesebuch für österreichische Lyrik. Für Dichterinnen und Dichter aus Deutschland hat ein solches der Göttinger Germanistikprofessor Heinrich Detering ediert. Diese umfangreiche Anthologie, Einführung und Vertiefung in einem liegt in der jüngsten Ausgabe in einer preiswerten Broschur vor. (9) Eine Alternative dazu stellen die seit 1970 erscheinenden Ausgaben der Zeitschrift PODIUM des gleichnamigen Literaturvereins dar (10) sowie der 2008 überarbeitete, vom Haymon Verlag neu aufgelegte Band „Neue österreichische Lyrik und kein Wort Deutsch“ von Gerald Kurdoglu Nitsche, der sich auf Lyrik sprachlicher Minderheiten konzentriert.
Der Verlag Berger aus Horn, Niederösterreich, hat jüngst mit „Neue Lyrik aus Österreich“ eine Reihe initiiert, in der seit 2013 unter anderem Bände von Gerhard Ruiss, Barbara Pumhösel und Gerhard Wall erschienen sind. (11) Mehr als zwölf Jahre älter ist der auf Lyrik spezialisierte Wiener Verlag Edition Korrespondenzen, dessen aus Bern gebürtiger Leiter Reto Ziegler beim Verlagsnamen gern nicht nur auf Charles Baudelaires Poem „Correspondances“ verweist, sondern auch auf die Métro von Paris. „Corréspondance“ steht dort für Verbindungen und Umsteigemöglichkeiten. Deshalb ist Zieglers Auswahl programmatisch international, vom Schweizer Kurt Aebli über tschechische, polnische, serbische, holländische Dichter bis zu Elfriede Czurda, Ilse Aichinger und dessen Schwester Helga Michie.
Weitere namhafte österreichische Lyrikerinnen und Lyriker sind Friederike Mayröcker, Julian Schutting, Alfred Kolleritsch, Christoph W. Bauer, Robert Schindel, Christine Busta, Christine Lavant, Hans Raimund und Peter Waterhouse und Sophie Reyer. Der Tiroler Markus Köhle, wie Mieze Medusa (Doris Mitterbacher) österreichischer Poetry Slammer von Format und Mitbegründer der Wiener Lesebühne „Dogma. Chronik. Arschtritt“, betreut Slam-Events in der Alten Schmiede in Wien und in der Bäckerei Innsbruck.
Überhaupt scheint in den Programmen österreichischer Verlage die Poesie noch immer stark auf, von Droschl, Graz (Elfriede Gerstl, Gerald Bisinger, Franz Josef Czernin) und Wieser, Klagenfurt (Cvetka Lipus, Gerhard Kofler) über Czernin, Wien (Christian Futscher) bis zur Edition Baes in Tirol, deren Schwerpunkt Beatlyrik ist, und dem Otto Müller Verlag in Salzburg. Jüngst erschien dort der erste Poesieband der Romanautorin Elisabeth Reichart. Darin heißt es, und zwar so kondensiert poetisch eben nur in der Form eines Gedichts ausdrückbar: „Schon legt sich die Dunkelheit auf das Wasser / ertrinkt ein Schrei in dem schwarzen See / leckt das Boot, das seinen Hafen nicht fand / kehren die schwebenden Nebel heim ins Gebüsch / Stille / Am Ufer lauert ihr Gegner“. (12)
Anmerkungen
1) Michael Krüger: Umstellung der Zeit.Berlin: Suhrkamp Verlag 2013, 3. Auflage 2014.
2) Ronald Pofalla, deutscher Politiker, von 2009 bis Ende 2013 Chef des Bundeskanzleramts in Berlin
3) Mehr unter www.peter-huchel-preis.de
4) Mehr unter www.lyrikpreis-meran.org
5) Mehr unter www.lyrikfestival-basel.ch
6) Mehr unter www.heidegg.ch
7) Mehr unter www.lyrik-kabinett.de
8) Raoul Schrott: Die Blüte des nackten Körpers. Liebesgedichte aus dem alten Ägypten. München: Hanser Verlag 2010.
9) Heinrich Detering (Hg.): Reclams Großes Buch der deutschen Gedichte. Stuttgart: Reclam Verlag 2013.
10) Mehr unter www.podiumliteratur.at
11) Mehr unter www.verlag-berger.at/erlesenes/neue-lyrik-aus-oesterreich.html
12) Elisabeth Reichart: In der Mondsichel und anderen Herzgegenden. Salzburg: Otto Müller Verlag 2013.