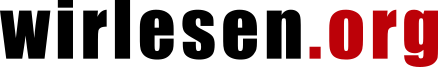Mit einiger Distanz betrachtet ist das Lesen von Büchern eine merkwürdige Tätigkeit. Was bringt Menschen dazu, stundenlang still zu sitzen oder zu liegen und auf einen gebundenen Stapel bedruckten Papiers zu schauen? Welche Vorstellungen, Gedanken und Gefühle sind damit verbunden, welche Bedeutung hat das Lesen von Büchern für die Einzelnen und für die Gesellschaft und wie verändert sich all das im Laufe der Geschichte? Nicht nur Psychologie und Literaturwissenschaft, sondern auch Romane und Erzählungen setzen sich immer wieder mit diesen Fragen auseinander, besonders intensiv in Zeiten kultureller Umwälzungen. Die Literatur wirft freilich einen ganz spezifischen Blick auf das Bücherlesen und seine Geschichte, eröffnet einen Zugang zu Dimensionen der Lektüre, die der traditionellen Leseforschung verborgen bleiben. Das sollen einige Schlaglichter auf Lesedarstellungen in der Gegenwartsliteratur zeigen.
Zugang zur fremden Vergangenheit
"Es gibt Emotionen, die existieren nur mehr durch das Buch. Was zum Beispiel 'Ehre' bedeutet, in einem glaubwürdigen Sinn und Pathos des Wortes, können wir in unseren Verhältnissen nicht mehr erfahren. Aber im Medium der Erregungen, in die uns etwa die Lektüre von Kleists 'Marquise von O …' versetzt, füllt sich das leere, entfallene Wort plötzlich mit seinem ganzen sozialen und lebensgefährlichen Ernst (…). Einen solchen abrupten Zuwachs von Gedächtnis kann letztlich nur das Buch ermöglichen. Es setzt das strikte, ungestörte Alleinsein mit dem abwesenden Autor und die stimmlose Ein-Mann-Sprache des Erzählens voraus. Es setzt voraus, dass wir den Text als etwas Übriggebliebenes, als Originalfundstück, als Rest auflesen." Botho Strauß' Erzählung "Die Widmung" (1977) bringt eine Funktion des Bücherlesens zur Sprache, die für unser Verhältnis zur Geschichte grundlegenden Charakter hat und die in der neuen Medienwelt zu verschwinden droht. Das Lesen von Literatur aus früheren Zeiten ermöglicht laut Strauß nämlich einen privilegierten Zugang zum kulturellen Gedächtnis, zu historischen Denk- und Handlungsweisen, zu Wertmaßstäben und kulturellen Erfahrungen, die im Akt des Lesens noch einmal durchlebt und damit verstanden werden können. Dieser Zugang wird freilich nicht durch das Vermitteln von geschichtlichen Informationen bewerkstelligt, sondern auf der Ebene des Gefühls.
Um den alten Begriffen wieder Bedeutung zu verleihen, müssen die Lesenden in "Erregung" versetzt werden. Dafür seien aber weder Theateraufführungen noch Filme geeignet, sondern nur Bücher. Das Bücherlesen lässt nämlich die Distanz, die uns von den historischen Lebens- und Wahrnehmungsweisen trennt, nicht verschwinden, wie dramatische und audiovisuelle Darstellungen das tun. Bereits der antiquierte Sprachstil älterer Literatur erschwert eine platte Vergegenwärtigung. Dazu kommen die medialen Charakteristika der Lektüre. Die sinnliche Kargheit und der Abstraktionsgrad des schriftlichen Codes laufen einer Präsenz der Vergangenheit zuwider, präsent ist allein das Gefühl. Erst durch diese Spannung zwischen emotionaler Erregung und medialer Distanz wird es möglich, an Erlebnissen teilzuhaben, die weit vor der eigenen Lebenszeit liegen, erst dadurch wird es möglich, Vergangenes als Fremdes zu verstehen, sich dem "Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit" (Alexander Kluge) zu widersetzen.
Lesen und Weltwahrnehmung
Einen besonders vielschichtigen poetischen Diskurs über das Lesen entwickelt das Werk Peter Handkes. Die zentrale Funktion der Lektüre liegt für ihn in der Erweiterung und Intensivierung der Wahrnehmung. Lesen bedeutet nicht, wie erwartbar wäre, eine Abkehr von der Wirklichkeit, sondern im Gegenteil eine explizite Hinwendung zu ihr. Handkes Protagonistinnen und Protagonisten entfliehen der Welt nicht, sondern praktizieren ein "Sich-in-die-Welt-hinaus-Lesen", das die Sinne schärft, die eingefahrenen Muster durchbricht und die Erde mit neuen Augen sehen lehrt. Diese gesteigerte Wahrnehmung ist allerdings nicht mit jeder Leseweise zu haben, sondern sie erfordert eine besonders intensive Form der Lektüre, die von Handke in seinem Roman "Der Bildverlust" (2002) als "studierendes" bzw. "buchstabierendes" Lesen bezeichnet wird und die nur langsam vor sich gehen kann. "Ein Lesen wie nur je eines: buchstabierend, lautlos die Lippen bewegend, hier und da einen Wort-Laut ausstoßend, und noch einmal, und noch einmal, innehaltend, die Augen vom Buch hebend und dem gerade Gelesenen nachgehend, im Umfeld, dem näheren und dem weiteren."
In diesen Zeilen sind alle Elemente versammelt, die Handkes Vorstellung eines idealen Lesens ausmachen. Lippenbewegung und Stimme zeugen von höchster Intensität, wie sie auch das vormoderne, laute Lesen auszeichnete. Gleichzeitig zeigen sich Momente einer emanzipatorischen Lektüre. Die lesende Heldin in Handkes Roman ist nicht in ihr Buch versunken, sondern kann sich reflektierend von ihm lösen, es mit ihrer Umwelt, ihrer Situation, ihrem Leben in Beziehung setzen. Dazu kommt die Bedachtsamkeit, mit der mit dem Text umgegangen wird und die sich diametral von den Formen des Lesens unterscheidet, wie sie sich gegenwärtig verbreiten. Laut aktuellen empirischen Studien wandeln sich die Lesestrategien in Richtung überfliegendes Lesen, Heraussuchen kleiner Informationsbrocken, paralleler und partieller Lektüre mehrerer Bücher. Solch oberflächliche Lektüre ist als Reaktion auf die wachsende Informationsflut verständlich, intensive Leseerfahrungen können so freilich nicht mehr gemacht werden.
Handkes Lesekonzept propagiert demgegenüber das genaue Gegenteil. Er hält dem "Durchschnüffeln" der Texte eine Exaktheit und Langsamkeit der Lektüre entgegen, die beinahe rituellen Charakter annimmt: Der Lesesessel wird ans Fenster gerückt, dann heisst es: "Jetzt wird gelesen!", beim Aufschlagen des Buches ertönt "ein Laut von sich öffnenden Lippen, sehr leise und sanft", der Finger folgt den Zeilen, "das Umblättern geradezu eine Zeremonie". Ein weiterer Bestandteil der im "Bildverlust" so pathetisch in Szene gesetzten Lektüre ist der stete Hinweis auf den Akt des Buchstabierens und Entzifferns. Darin drückt sich ein Bewusstsein aus, für das die Materialität der Zeichen im Akt des Lesens noch präsent ist. All das konvergiert in einem poetischen Programm der Verlangsamung und der Erhöhung der Intensität, das sich der Logik der herrschenden Medien entgegenstellt und dem letztlich auch die Form von Handkes Texten entspricht.
Die existentielle Dimension des Lesens
Der Zusammenhang zwischen der Verbreitung des stillen, einsamen Bücherlesen im 18. Jahrhundert und der Herausbildung des bürgerlichen Individuums ist historisch evident. Aber auch heute kann die Lektüre noch eine zentrale Rolle in der Ich-Entwicklung spielen, darauf verweisen die literarischen Lesedarstellungen nachdrücklich, etwa die im Jahr 2000 erschienene Erzählung "Leben zwischen den Seiten" der österreichischen Autorin Corinna Soria. Die Protagonistin, ein kleines Mädchen, wächst bei ihrer psychisch kranken Mutter auf. Das Lesen dient ihr zur Aufrechterhaltung ihrer psychischen Integrität, als Trost nach traumatisierenden Erlebnissen und als einzige Quelle einer wenigstens temporären Geborgenheit. Sie fühlt sich "aufgehoben im Rhythmus der Sprache", kann durch Gedichtzeilen ihre Seelennot benennen, sie damit bannen und sich ihrer Existenz versichern.
Die fiktiven Welten ihrer Indianerbücher sind der einzige Rückzugsraum, die auswendig rezitierten Verse von Schiller, Rückert und anderen der einzige Halt, wenn das Mädchen die Wahnschübe seiner Mutter, die Strafen der Pflegemutter oder das Eingreifen von Psychiatrie und Jugendamt nicht mehr zu ertragen vermag. "Ohne Bücher kann ich nicht schlafen, atmen, sein, ohne Bücher ersticke ich, gehe verloren, verliere mich, ohne Bücher verhungere, verdurste, verschwinde ich." Die Besonderheit von Sorias Erzählung ist die Verbindung von poetischer Intensität und psychologischer Authentizität, der scharfe Blick für die existentielle Dimension des kindlichen Leseerlebnisses, für die Fähigkeit, bei der Lektüre alles rundherum wegzublenden und sich in einem tiefen Lustempfinden zu verlieren.
Sorias Erzählung lenkt darüber hinaus die Aufmerksamkeit auf die medialen Grundlagen der Leselust. Sie macht deutlich, wie Kinder Bücher als Partituren nutzen, nach denen sie ihre Phantasien ausbreiten, aber auch wie karg im Vergleich zu den audiovisuellen Medien die Basis für diese Phantasien ist. Um die schwarzen Lettern auf dem weißen Papier zu spannenden Geschichten bzw. imaginären Räumen zu beleben, ist eine wesentlich größere Einbildungskraft vonnöten, als bei der Rezeption von Audiovisuellem, das ja unmittelbar mit den Sinnen wahrgenommen werden kann. Doch gerade die geforderte Einbildungskraft ist für die Intensität des Leseerlebnisses verantwortlich. Da der Text erst imaginiert und vervollständigt werden muss, werden wesentlich größere affektive Energien frei als beim Film- oder TV-Konsum. Dazu kommen spezifische Entgrenzungserfahrungen, denn dadurch, dass die fiktiven Welten von den Lesenden selbst geschaffen werden, lösen sich für das Ich die Grenzen zwischen Innen- und Außenwelt auf, während bei den audiovisuellen Medien – zumindest in den derzeit verbreiteten Artefakten – die Trennung zwischen Ich und Medium, zwischen Instanz der Wahrnehmung und wahrgenommenen Bildern und Tönen aufrecht bleibt. Die Rezipientinnen und Rezipienten verharren in ihrer Rolle als Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor dem Bildschirm ist eben nicht "zwischen den Seiten".
Die Medialität des Lesens
Wie gelesen wird und welche Folgen die Lektüre zeitigt, hat also nicht nur mit dem jeweiligen Text zu tun, sondern hängt ganz wesentlich vom Lesemedium ab. Die Lektüre am Bildschirm und das Lesen gedruckter Bücher unterscheiden sich daher grundlegend, darauf verweist auch eine utopische Erzählung des DDR-Autors Franz Fühmann mit dem Titel "Pavlos Papierbuch" (1982). Im Jahr 3456 sind Papierbücher rare Sammlerstücke geworden, üblicherweise werden "Mikrofilme oder Lesekarten" mit Hilfe von "Leseschirmen" oder "Leselupen" zur Lektüre benützt. Diese Form der "Informationsübermittlung" entbehrt allerdings jeder sinnlichen Qualität. Sie ist "unfühlbar, unhörbar, unriechbar, unschmeckbar, und in keinem natürlichen Größenverhältnis zu einem menschlichen Organ." Dem wird die "sinnliche Selbstoffenbarung" der Papierbücher gegenübergesetzt, die schon "prinzipiell etwas Anderes waren" und deren Charakteristika dem Lesenden der Zukunft sofort deutlich werden, weil sie ihm nicht durch Gewöhnung selbstverständlich geworden sind wie uns.
Ein Papierbuch lässt sich im wahrsten Sinne des Wortes begreifen ("Dass man es anfassen konnte wie einen Leib!"), es hat einen besonderen Geruch, einen Klang, spürbare Konturen und Materialeigenschaften. "Jede seiner Seiten war ein Gebilde, das ringsum mit Blicken abschreitbar war, ein Mass an Raum, in sich geschlossen, und damit auch ein Mass für die Zeit. Dieses Mass war menschlich, weil überschaubar." Dem stehen die Unüberschaubarkeit und Immaterialität der Bildschirmtexte gegenüber, die alle menschliche Kapazität übersteigen und die Orientierung schwierig machen. "Was beim Papierbuch ein geistiger Raum war, wurde im Lesegerät ein Fließband, auf Knöpfchendruck von Ort zu Ort ruckend, dass die Akte der Rezipierung geschähen, mechanische Zugriffe des Hirnes; und wenn der Benutzer dieses Band auch auf dem Gesamtweg begleiten konnte, erschien ihm dieser doch niemals fassbar. (…) Einem Mikrofilmröllchen entnahm man nicht sinnenhaft, wie viel Lesezeit es in sich barg; beim Papierbuch wog man mit Hand und Auge, man sah, wen man da vor sich hatte".
Mit poetischer Anschaulichkeit und medientheoretischer Präzision führt Fühmanns Text schon kurz nach der Erfindung des PCs vor, welche Folgen das jeweilige Medium für den Akt des Lesens hat. Während man beim Buch in einen Denk- und Vorstellungsraum eintritt, legt der Bildschirm eine überfliegende Leseweise nahe, die einzelne Informationseinheiten aus dem Textfluss herauspickt, ohne ihre Position im Gesamttext verorten zu können. Beim Buch haben wir es immer mit einem bestimmten, abgeschlossenen Text zu tun, am Bildschirm liegt uns bloß ein Ausschnitt aus der gesamten digitalen Bibliothek vor Augen.
So zeigen bereits diese wenigen Beispiele, wie eindringlich und genau sich die moderne Literatur mit dem Bücherlesen beschäftigt. Über dessen Zukunft erlauben sie freilich keine verlässlichen Aussagen. Wohl aber ermöglichen sie einen neuen Blick darauf, welche Funktionen des Lesens auch in Zukunft von Bedeutung wären bzw. was verloren ginge, sollte diese Kulturtechnik tatsächlich in die Marginalität gedrängt werden, wie ihr das schon seit Jahrzehnten prophezeit wird.
Dieser Artikel ist erstmals in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen.