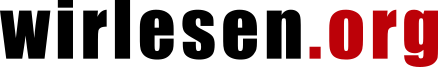Eine wichtige Rolle spielten dabei Märchenverfilmungen, die zwar auch die erwachsene Zielgruppe ansprechen sollten, jedoch gleichzeitig die erste Form der jugendgerechten visuellen Unterhaltung darstellten. Der tschechische Märchenfilm war hierbei Vorreiter. Zum Erfolg dieser damals auch im Westen sehr beliebten Filme befragt, stellt der tschechische Regisseur Zdenek Zelenka in einem Interview mit Gerald Schubert für Radio Praha fest: „Das liegt unter anderem daran, dass sich zur Zeit des Sozialismus viele absolute Spitzenleute mit diesem Genre beschäftigt haben, weil sie aus politischen Gründen keine anderen Filme drehen konnten. Also gerade die Besten haben sich sehr oft diesem – wie man damals sagte – ‚Zufluchtsgenre’ gewidmet.“ (1) Auch der Disney-Konzern – der Inbegriff für Kinder und Familienunterhaltung – greift immer wieder Märchen- und Sagenstoffe in seinen Filmen auf. Disney perfektionierte zudem die Form der auf verschiedenen Ebenen ablaufenden Handlung. So rezipieren verschiedene Altersgruppen die Filme auf unterschiedliche Weise und auf verschiedenen Wahrnehmungsebenen – unterhalten werden die ZuseherInnen aber alle.
Der Trend der verwischenden Grenzen zwischen Jugend- und Erwachsenenliteratur – vor allem im Bereich der fantastischen Literatur – ist auch am Filmmarkt unübersehbar. So wurden in den letzten Jahren vermehrt Bücher aus diesem Segment für die Leinwand umgesetzt („Harry Potter“, „Der Herr der Ringe“, „Die Chroniken von Narnia“, „Eragon“, „Tintenherz“ …). Eine Tatsache, die durchaus positiv zu bewerten ist, da sie den Jugendfilm neu belebt.
Realverfilmungen
Vermehrt werden neben dem im Kinder- und Jugendbereich omnipräsenten Genre der Animationsfilme auch wieder Realverfilmungen produziert. Die erstarkte deutsche Filmindustrie (2011: 21,8 Prozent deutscher Marktanteil der in den Kinos gezeigten Filme, Quelle: FFA – Filmforderungsanstalt Deutschland) trägt hierzu durch die Verfilmung von Kinderklassikern und erfolgreichen Büchern einen beachtlichen Teil bei: „Freche Mädchen“, „Hexe Lilli“, „Die drei ???“, „Vorstadtkrokodile“, „Lauras Stern“, „Wickie“, „Hanni und Nanni“… Doch auch aus dem englischsprachigen Raum kommen zahlreiche Produktionen für das junge Publikum: „Die Chroniken von Narnia“, „Winn Dixie“, „Millions“, „Hugo Cabret“, „Eine für vier“, „Eine zauberhafte Nanny“, „Charlie und die Schokoladenfabrik“, „Percy Jackson“, „Alabama Moon“, „Wintertochter“ …
Nicht unerwähnt bleiben darf natürlich der skandinavische Kinder- und Jugendfilm, der vor allem mit den Astrid-Lindgren-Verfilmungen das Genre mitprägte und nach wie vor eine bedeutende Rolle spielt.
TV-Produktionen
Filme und Serien für Kinder und Jugendliche wurden und werden großteils für das Fernsehen produziert. Aus diesem Grund waren – im Gegensatz zum Videomarkt für Erwachsene, auf dem erst seit einigen Jahren verstärkt Fernsehproduktionen veröffentlicht werden – Zweitverwertungen auf Video und DVD im Kinder- und Jugendbereich schon immer von großer Bedeutung. Zudem werden meist Vorlagen mit beliebten, gut eingeführten Charakteren bzw. das x-te Remake anstatt eines neuen, unbekannten Stoffs umgesetzt. Sabine Wallach bringt es in ihrem Text über Literaturverfilmungen in dem von Jens Thiele herausgegebenen „Handbuch Kinderliteratur“ treffend auf den Punkt: „Das liegt zum einen sicher an einem Mangel an qualitativ hochwertigen Drehbüchern, zum anderen aber auch an der Popularität einer Vorlage, die rückwirken sollte auf eine breitere Rezeption des Films. Gerade für den Kinderfilmbereich ist diese Wechselwirkung bzw. der Imagetransfer bis heute charakteristisch.“ (2)
Filme für Jugendliche
Der anspruchsvolle Jugendfilm ist im Vergleich zum Kinderfilm fast nicht vorhanden. Dies ist sicher eine Konsequenz aus der mit steigendem Alter zunehmenden Orientierung auf dem Erwachsenenmarkt. Einen Boom erlebte das Genre der amerikanischen Teenagerkomödien, die leider oftmals nicht mehr als dumpfe Klamaukfilme sind.
Auch hier schafft der neue deutsche Film, welcher immer wieder differenziert gezeichnete, feinfühlige Jugendfilme hervorbringt, ein Gegengewicht („Grüne Wuste“, „Nach fünf im Urwald“, „Crazy“, „alaska.de“, „Fickende Fische“, „Kroko“, „Die Perlmutterfarbe“, „Die Welle“, „Wer küsst schon einen Leguan?“...).
Videos, DVDs, Blu-rays
Die Videokassette ist im Jahr 2012 Geschichte. Auch im Kinder- und Jugendbereich werden keine Titel mehr in diesem Format veröffentlicht. Selbst wenn im einen oder anderen Kinderzimmer sicher noch Videoabspielgerate und Videokassetten zu finden sind, ist der Umstieg auf den DVD-Verleih – falls er nicht schon längst erfolgt ist – für Bibliotheken unumgänglich. Da im Gegensatz zu den anfangs hohen Preisen die Kosten – aber leider auch die Ausstattung – für eine DVD rapide gesunken sind, durfte dies budgetär einfach zu bewerkstelligen sein. Die vorhandenen Vorzüge wie verschiedene Sprachspuren und Direktzugriff auf einzelne Kapitel machen den Abschied leicht.
Der direkte Nachfolger der DVD ist die Blu-ray. Dieses Speichermedium hat sich gegen die HD-DVD durchgesetzt und bietet durch die um ein Vielfaches höhere Speicherkapazität die Möglichkeit, Filme in hoch auflösender HD-Qualität zu speichern. Voraussetzungen sind ein Blu-ray-Player und ein HD-Fernseher. Der Anteil der verkauften Blu-rays im Vergleich zur DVD lag in Deutschland im Jahr 2010 bei 14 Prozent (Quelle: Bundesverband Audiovisueller Medien). Falls in der Bibliothek schon ein Blu-ray-Bestand vorhanden ist, empfiehlt es sich durchaus, den einen oder anderen Kinderfilm mit anzukaufen. Das Hauptaugenmerk sollte im Moment aber noch klar auf dem Angebot im DVD-Format liegen.
Anmerkungen:
(1) Gerald Schubert: Aschenbrodel und Co.: Tschechischer Märchenfilm eroberte die Bildschirme der Welt (Stand 26. 08. 2013).
(2) Sabine Wallach: Literaturverfilmungen. In: Jens Thiele (Hrsg.): Handbuch Kinderliteratur: Grundwissen für Ausbildung und Praxis. Herder Verlag, 2003, ISBN 3-451-28140-6, S. 207.