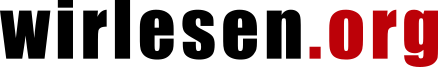„Eine mögliche Antwort, warum es Bibliotheken oft nicht gelingt, in einer Zeitung Eingang zu finden, liegt im Image dieser Einrichtungen. Eher selten werden sie mit ihren Leistungen und Aktionen als interessantes und sensationelles Pressemotiv wahrgenommen.“ (1)
Pressearbeit in der öffentlichen Bibliothek ist längst zur Medienarbeit geworden und als ein Instrument von Öffentlichkeitsarbeit zu verstehen – früher gerichtet an RedakteurInnen und JournalistInnen etwa von Tageszeitungen, Radio oder Fernsehen, heute erweitert um die Möglichkeiten, die das Internet bietet. Öffentliche Bibliotheken setzen Pressearbeit ein, um über jüngste oder bevorstehende Entwicklungen oder Angebote zu informieren, Veränderungen mitzuteilen, über Projekte oder Veranstaltungen zu berichten, statistische Zahlen nach außen zu geben – um Aktuelles zu verbreiten: Medienarbeit wird zumeist für Neuigkeiten eingesetzt!
Ich beziehe mich im Folgenden beispielhaft auf die Ankündigung einer Veranstaltung in einer öffentlichen Bibliothek, vieles kann allerdings auf andere Arbeitsbereiche übertragen werden.
An Grundsätzen zur Gestaltung von Pressemeldungen ist viel und viel Richtiges gesagt und geschrieben worden, vor allem auf dem weiten Feld der Werbung. Einige Buchstaben haben überdauert und sind als zeitlos gültig anzusehen – so etwa die berühmten sieben „Ws“, die einem vielleicht noch aus der Schule in Erinnerung sind (wer, was, wann, wo, wem, warum, wie), variiert und umgelegt auf Werbebranche im weitesten Sinne in den Fragestellungen „was, wo, wann, wer, wem, warum/wozu und wie“ oder auch „wer, was, wann, wo, wie, warum, woher“.
Wer? Wo? Was? Wann?
In Anlehnung an die Schule (einen Text zusammenfassend: Wer hat was wann wo, wie und warum getan?) reichen für eine Ankündigung vielleicht vier Ws aus, um es möglichst richtig zu machen: Wer? – die Autorin/der Autor – wird – wo? – in der Öffentlichen Bibliothek XY – was? – ihr/sein neuestes Buch – wann? – am Tag X zur Stunde null vorstellen. Und daraus lesen. Klingt einfach, ist es auch: Name, Titel, Ort und Datum mit Uhrzeit. WWWW. Kombiniert mit KISS vielleicht. Dieses Prinzip soll angeblich von einem Ingenieur bei Lockheed formuliert worden sein, der damit ursprünglich „Keep it simple (and) stupid“ abgekürzt haben soll, also vielleicht: Mach es möglichst einfach! Die Werbebranche machte daraus „Keep it short (and) simple – halte sie kurz und einfach – deine Botschaft nämlich! Das gilt für eine Vorankündigung mit der Bitte um Bekanntmachung und Verbreitung ebenso wie für eine Nachbereitung, die man den Medien nach einer allfälligen Veranstaltung schickt: Wer hat wann wo was gemacht (vor wie großem Publikum vielleicht, in Anwesenheit wie vieler Besucherinnen und Besucher)?
Wem? Wozu? Wie?
Bleiben zumindest drei weitere Ws, die ich von den oberen vier eindeutig trenne würde – beziehen sich doch die ersten vier eindeutig auf eine Information, die ich weiterleite, auf nackte Fakten:
„Wem“ übermittle ich diese Information? Das kann die Regionalzeitung sein oder das überregionale Blatt, die Tages- oder die Wochenzeitung, die Gemeindezeitung, der Pfarrbrief, der lokale Radio- oder Fernsehsender, ein Landesstudio, in den seltensten Fällen wohl der staatliche Rundfunk. Im Allgemeinen ist es empfehlenswert, sich über die Zeit Kontakte zu fixen Ansprechpersonen bei den jeweiligen Einrichtungen einzurichten, das vergrößert im Normallfall die Chancen auf eine gut platzierte Ankündigung bzw. Berichterstattung im Nachfeld. Für Ankündigung und Berichterstattung gibt es zumeist unterschiedliche Ansprechpartner; Einladungen an privat (z. B. Leserinnen und Leser), an bestimmte Zielgruppen oder Institutionen sind Teil der Öffentlichkeitsarbeit, aber natürlich nicht Teil der Medienarbeit.
Wozu/warum übermittle ich diese Information? Um von etwas zu berichten, auf etwas neugierig und aufmerksam zu machen; um möglichst viele Menschen zu erreiche und eine große Zahl von BesucherInnen einzuladen; um die Aktivitäten der Bibliothek entsprechend zu „verkaufen“! Um präsent zu sein, nicht zuletzt, um die Leistungen unseres Teams, unser Angebot und die Vielfalt unserer Aktivitäten ins rechte Licht zu rücken.
„Wie“ transportiere ich meinen Inhalt, abgesehen von „short and simple“? Nun ja, so vollständig wie möglich, so informativ wie möglich, so anregend wie möglich. Kurze Sätze sind ratsam. Von Zusammenfassungen, die große Teile des Inhaltes vorwegnehmen, ist eher abzuraten, auch im Sinne der Autorin/des Autors, die/der daraus lesen soll. 15- bis 20-zeilige Texte reichen aus, versehen mit einem guten Titel und einem ebensolchen Bild als „Eyecatcher“!
Das achte „W“
Während man den Text des Verlages, mit dem dieser das neue Buch einer/eines seiner AutorInnen ankündigt, in der Regel getrost unverändert übernehmen kann (ohne Nennung der Urheberschaft), auch, weil üblicherweise auf den Inhalt Verlass ist, ist Vorsicht geboten bei der Verwendung von Bildmaterial. Viele Verlage stellen mittlerweile Porträtfotos ihrer AutorInnen zur honorarfreien Verwendung zur Verfügung, sei es zur Online-Bewerbung auf einer Bibliotheks- oder Gemeinde-Website oder auch zur – elektronischen – Weitergabe an Medien oder in Einladungen per E-Mail. Bei der Verwendung eines Buchcovers, das der Verlag zur Verfügung gestellt hat, nenne ich dann auch den Verlag als Urheber.
Womit ich bei einem weiteren W ankomme, das meiner Auffassung nach zu wenig Beachtung findet bei der Umlegung der berühmten W auf die Pressearbeit, das aber unbedingt berücksichtigt werden sollte – als Frage wohl am besten formuliert mit: Woher habe ich meine Information? Welche Quelle, welche Urheberin/welcher Urheber steht hinter einem Text, einem allfälligen Zitat, einem Bild? Knapp und schlicht formuliert: Quellen sind anzuführen, auch wenn ein Foto honorarfrei zur Verfügung gestellt wird (üblicherweise nennt der Verlag die Fotografin/den Fotografen ja auch mit der Übersendung eines Bildes bzw. ersucht um Namensnennung). Das gilt sowohl für die klassische Bewerbung im Internet, auf Plakaten oder Flyern als auch für Einladungen, die versendet werden, ob als Print oder elektronisch. Und das gilt für Artikel, die Sie – eventuell mit einem Foto von der Veranstaltung mit einem kurzen Text zum Bild – im Nachhinein an Medien versenden. Bildern aus dem Internet ist prinzipiell zu misstrauen: Vergewissern Sie sich, ob eine Urheberin/ein Urheber angeführt werden muss und ob das Material honorarfrei verwendet werden darf. Für Fotos, die Sie bei Veranstaltungen von Kindern schießen, muss vor Veröffentlichung das Einverständnis von Erziehungsberechtigten eingeholt werden. Und prüfen Sie speziell Texte, die im Internet zur freien Verfügung stehen, auf Fehler – auch PR-Menschen von Verlagen sind vor Rechtschreibfehlern nicht gefeit!
Noch einmal: Wann?
Ein anderes, internes „Wann?“ formuliert schließlich die Frage: Wann gehe ich mit meiner Information nach außen? Es empfiehlt sich, die Medien (bei Printmedien abhängig von deren Erscheinungsintervallen) zumindest zwei Wochen vor einer Veranstaltung zu informieren, unter Nennung einer Kontaktperson mit Kontaktmöglichkeiten (Telefon, E-Mail, Erreichbarkeit!) für Rückfragen. Nachhaken macht Sinn, am besten telefonisch, am besten vormittags. Ein allfälliges Pressegespräch ist ebenfalls am Vormittag sinnvoll: Zu diesem Zweck ist professionell gestaltetes Material („Pressemappe“) in ausreichendem Umfang bereitzulegen.
Presseartikel sollten anschließend gesammelt werden, dokumentieren sie doch die geleistete Arbeit und belegen sie die Wahrnehmung von außen!
Summing up – to keep it short and simple: Fassen wir uns kurz. Halten wir geschriebene Gesetze genauso ein wie ungeschriebene Fairplay-Regeln! Klauen wir nicht! Vertrauen wir auf unsere Formulierungen und damit Fähigkeiten! Machen wir es spannend! Verkaufen wir uns gut!
(1) Ilona Munique, zitiert aus einem Artikel über Öffentlichkeitsarbeit: „Nur (r)eine Imagesache? Werbung in deutschen Bibliotheken – und wie sie (nicht) funktioniert. Quelle: http://www.wegateam.de/download/wega_artikel03.pdf (Stand 29.08.2013)