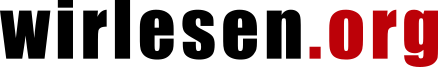2001 läutete Donata Elschenbroich, Forscherin der frühen Kindheit, mit ihrem Buch „Weltwissen der Siebenjährigen. Wie Kinder die Welt entdecken können“ (1) einen Paradigmenwechsel in Bildungseinrichtungen wie Kinderkrippen, -gärten und Schulen sowie in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit ein: Kinder sind begeisterte LernerInnen, ForscherInnen, WeltentdeckerInnen. Kinder als NaturforscherInnen dokumentieren den vollzogenen Paradigmenwechsel vom Lernen durch Belehren hin zum Lernen durch Fragen. Das Kind irrt nicht mehr orientierungslos durch das „Wunderland des Wissens“ (2), um dort mittels gut aufgemachter Sachliteratur für „die Sache“ interessiert zu werden. „Alle Kinder kommen mit einer unglaublichen Lernfähigkeit zur Welt: Ihre Wissbegierde und Entdeckerfreude ist kaum zu stillen, sie sprudeln über vor Gestaltungslust und Gestaltungskraft. Sie stecken voller Energie und Tatendrang und sind immer in Bewegung.“ (3) Hoffnungsvolles Potenzial auf Seiten der LeserInnen und ein Anreiz für BibliothekarInnen, den Sachbuchbestand nach diesen Kriterien zu sichten: Welche Bücher werden diesen Ansprüchen gerecht? Wie viel Forscherdrang befriedigt das Sachbuchangebot, wie aktuell ist der Bestand, wie attraktiv ist er präsentiert?
Vom Sachproblem zum Weltwissen
„Nachdenken statt bloße Fakten, das ist der Genuss, den gute Sachbücher bieten“, stellt Hans ten Doornkaat fest und fordert ein „Sachbuchangebot, das die Neugierde lohnt.“(4) Keine „Faktenhuberei“ bzw. „reine Benennungsangebote“ sollen die Neugierde der LeserInnen gefährden, die längst ihren Laienstatus aufgegeben haben. Es geht in den aktuellen Sachbuchproduktionen nicht mehr um die Belehrung, sondern um Anregungen zum Forschen und Entdecken. Dieser Trend spiegelt sich in Buchtiteln wie „Komm mit, wir entdecken den Frühling“, „Das Bilder-Bastel-Erlebnisbuch“, „Wir entdecken die Steinzeit“ oder „Du bist die Erde“ wider. Hier wollen AutorInnen bzw. IllustratorInnen einerseits sachlich prägnant sein, andererseits die RezipientInnen – noch 1996 bezeichnet die Fachliteratur zum Sachbuch sie als „Nichtfachleute“ – gezielt als Gleichberechtigte ansprechen. „Komm ins Buch, dann forschen wir gemeinsam“, so das Credo dieser Publikationen. „Frag mich“ ist ein Leitmotiv der neuen Art des Lernens sowie der Entwicklung im Sachbuchbereich. Antje Damm hat mit ihrem Buch „Frag mich. 108 Fragen an Kinder, um miteinander ins Gespräch zu kommen“ (Moritz 2002) Gesprächsanlässe über Alltagsphänomene für Kinder und Erwachsene geschaffen. Alltagserfahrungen sind hier in jeder einzelnen Frage und der dazu gehörenden Illustration bzw. Fotografie angedeutet, die Frage liefert einen Redeanlass, fordert das Nachfragen seitens der Kinder und das Antworten seitens der erwachsenen Bezugspersonen ein. Donata Elschenbroich: „Die Welt ist der Inbegriff von allem, womit man Erfahrungen macht, wenn man in ihr ist. Dieses progressive Welteinwohnen beschäftigt uns lebenslang, aber in den frühen Stadien des Lebens ist es besonders abenteuerlich, verheißungsvoll, pionierhaft.“ (5)
Streben nach Selbstverwirklichung
Im gleichen Maß, wie nicht mehr klar zu sein scheint, was Kinder in der Schule wirklich lernen sollen, sind auch Ansprüche an das Sachbuch in Frage gestellt. Sachlich richtig, informativ und gut lesbar, das sollen laut Sekundärliteratur Sachbücher sein. Dass Wissen jedoch nicht reiner Selbstzweck ist, sondern dem Streben nach Selbstverwirklichung und damit nach erweiterter Handlungsfähigkeit dient, mahnen die Neurobiologen und Lernexperten der Gegenwart ein: „Indem das Kind mithilfe des übernommenen Wissens seine eigenen Erfahrungen macht, stellt es nun selbst eine emotionale Beziehung her, nicht nur zwischen sich und den betreffenden Bezugspersonen, sondern auch zwischen sich und all dem, was diesen Personen wichtig erscheint und womit sie in Beziehung stehen, ihren materiellen, aber auch ihren geistigen Produkten, ihrem Wissen über andere Menschen, über Tiere und Pflanzen, über Maschinen und Geräte, über die Welt und den Kosmos.“ (6)
Unwissend bleiben heißt resignieren
„… ich weiß auch sonst fast nichts, ich kenne nicht einmal die Namen der Blumen auf der Bachwiese. Ich habe sie im Naturgeschichtsunterricht nach Büchern und Zeichnungen gelernt, und ich habe sie vergessen wie alles, von dem ich mir keine Vorstellung machen konnte. Ich habe jahrelang mit Logarithmen gerechnet und habe keine Ahnung, wozu man sie braucht und was sie bedeuten. Es ist mir leicht gefallen, fremde Sprachen zu erlernen, aber aus Mangel an Gelegenheit lernte ich sie nie sprechen, und ihre Rechtschreibung und Grammatik habe ich vergessen. Ich weiß nicht, wann Karl VI. lebte, und ich weiß nicht genau, wo die Antillen liegen und wer dort lebt. Dabei war ich immer eine gute Schülerin.“ (7)
So lässt die österreichische Autorin Marlen Haushofer ihre Protagonistin in ihrem 1963 publizierten und 2012 verfilmten Roman über schulische Lernmethoden und gescheiterte Versuche von Weltaneignung sinnieren. Gelesenes, aber nicht Erlebtes, wird hier als unnützes, nicht abrufbares Weltwissen beschrieben, lange bevor 2006 Donata Elschenbroich einen gelungenen Lernakt mit „Das brauche ich mir nicht zu merken. Das habe ich erlebt.“ (8) skizziert. Sie will das Fragen – von Erwachsenen wie von Kindern – im Fluss halten: „Kinder zeigen auf alles. Mit ihrer Hilfe kann man in allen Lebensaltern die aus dem Alltag der Erwachsenen verschwundenen Fragen reaktivieren und sich selbst wieder anschließen an die frühe Aufmerksamkeit.“ (9)
Die Dinge und was sie Kinder alles lehren
Donata Elschenbroich lädt in ihrem Buch „Die Dinge“ zu Expeditionen zu den Gegenständen des täglichen Lebens ein. Die Wissenschaftlerin errichtet darin eine Weltwissen-Vitrine, eine „öffentliche Bibliothek der Dinge“, die vom Obstentkerner über das Nudelbrett, zum Handbohrer, zu Schiefertafel und Federkiel reicht. Wissen und Gegenstande gehören, davon ist Elschenbroich überzeugt, weder in einen Safe noch in einen Tabernakel, sondern hinaus in die Welt, in die Familien, die mit ihren Kindern über die Bedeutung der Dinge spricht. Dabei müssen die Erwachsenen nicht mehr als die Kinder wissen: Der Dialog ruft nämlich nicht nur Wissen ab, sondern bringt es selbst auch hervor. (10)
Anmerkungen:
(1) Donata Elschenbroich: Weltwissen der Siebenjährigen. Wie Kinder die Welt entdecken können. München: Kunstmann 2001
2) Hans Gärtner: Margaret Gorschenek/Annemaria Rucktaschel: Kommt, Kinder, ins Wunderland des Wissens! In: Kinder- und Jugendliteratur. München: Fink 1979 (Uni-Taschenbucher 742), S. 211.
3) Jirina Prekop/Gerald Huther: Auf Schatzsuche bei unseren Kindern. München: Kösel-Verlag, 5. Aufl. 2006, S. 24.
4) Hans ten Doornkaat: Einsichten und Ansichten zum erweiterten Sachbuchangebot. In: www.1001buch.at/ausgaben/3_03/doornkaat.html
5) Donata Elschenbroich: Weltwissen der Siebenjährigen. A.a.O., S. 10.
6) Karl Gebauer/ Gerald Huther (Hrsg.): Kinder brauchen Vertrauen. Düsseldorf: Patmos 2004, S. 15.
7) Marlen Haushofer: Die Wand. Düsseldorf: Claasen 1983, S. 85.
8) Donata Elschenbroich: Weltwunder. Kinder als Naturforscher. München: Kunstmann 2005, S. 12.
9) Donata Elschenbroich: Weltwunder. A.a.O., S. 13.
10) vgl. Donata Elschenbroich: Die Dinge. München: Kunstmann 2010, S. 182.