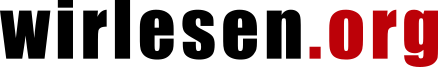"Mit Büchern kann man eine Kultur des Willkommen-Heißens, des Respekts und der Partizipation aufbauen", stellt Giusi Nicolini, der Bürgermeister von Lampedusa, in einem Statment zur "Silent Books"-Bibliothek fest.
Bücher ohne Worte sind besonders für diesen Brückenschlag geeignet, da sich für Menschen aller Nationen, Sprachen, Kulturkreise und Altersklassen öffnen. Diese Bilderbücher laden ein, Geschichten in eigenen Worten zu erzählen und immer wieder neu zu erfinden.
Bei der untenstehenden Auswahl wurde auf die besondere Qualität der Bücher geachtet, viele Titel sind mehrfach ausgezeichnet.
- Marije Tolman/Ronald Tolman: Die Insel, arsedition 2013
Ein Eisbär klettert auf eine Himmelsleiter in die Wolken und steigt auf einer Insel wieder herab. Dort begegnet er vielen anderen Tieren mit ihren Träumen, Sehnsüchten, Hoffnungen und Geschichten.
- Shaun Tan: Ein neues Land, Carlsen Verlag 2015
Was bringt Menschen dazu, alles zurückzulassen, um eine Reise in ein unbekanntes, fernes Land anzutreten, ohne Familie und Freunde, wo alles namenlos und die Zukunft unbekannt ist? Diese zutiefst berührende und packende Graphic Novel ist die Geschichte eines jeden Migranten, eines jeden Flüchtlings, eines jeden heimatlosen Menschen und eine Hommage an alle, die eben diese Reise angetreten haben.
- David Wiesner: Strandgut, Carlsen Verlag 2013
Ein Bub findet eine alte Unterwasserkamera am Strand. Er lässt die Fotos entwickeln, die höchst wundersame Welten zeigen: von vorlesenden Kraken bis zu schwimmenden Muschelstädten auf Schildkrötenrücken. Die Gestaltung des Buches ist eine Reminiszenz an die klassische Fotografie und den Film.
- David Wiesner: Herr Schnuffels, Aladin Verlag 2014
Herr Schnuffels ist ein ziemlich gelangweilter Kater. Bis sich eines Tages ein winziges Raumschiff samt außerirdischer Besatzung in die Wohnung verirrt. Kaum auf der Erde gelandet, müssen die kleinen grünen Männchen schon um ihr Leben fürchten, denn die Katze macht Jagd auf sie. Geredet wird in dem Buch sehr viel - allerdings auf „Alienisch“ und auf „Ameisisch“.
- Michael Roher: Fridolin Franse frisiert, Picus Verlag 2014
Zehn Schritte braucht es vom glatten Haar zur gewünschten Frisur: Kämmen, waschen, shampoonieren, spülen, schneiden, färben, einwirken lassen, auswaschen, eindrehen und föhnen. Die Haare wimmeln dabei nur so von Details und kleinen Episoden.
- Thé Tjong-Khing: Die Torte ist weg, Moritz Verlag 2015
Zwei Ratten stehlen die Torte des Hundepaares und werden nun verfolgt. Das ist eine von unzähligen Geschichten, die sich in diesem perfekt durchkomponierten Buch eröffnen. Erzählt wird nicht nach dem Prinzip von Wimmelbildern, denn wichtig ist gerade das kontinuierliche Erzählen durchs ganze Buch hindurch.
- Charlotte Dematons: Heute flieg ich…, aracari verlag 2013
Ein Mann wird festgenommen und bricht aus dem Gefängnis aus, ein blaues Auto geht auf große Reise, ein gelber Ballon fliegt um die Welt, ein Fakir auch – auf seinem Teppich. Dieses wunderbare Buch erschafft detailreiche Bilderwelten zwischen Realität und Fiktion.
- Alessandro Sanna: Der Fluss, Peter Hammer Verlag 2014
Alessandro Sanna gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen Illustratoren Italiens. Auf hunderten schmalen Panoramen zeigt er im Rhythmus der vier Jahreszeiten die Veränderungen von Landschaft durch das Voranschreiten der Zeit.
- Raymond Briggs: Der Schneemann, Aladin Verlag 2013
Ein kleiner Bub baut an einem Wintertag einen Schneemann, der in der folgenden Nacht zum Leben erwacht und mit dem man wunderbare Abenteuer erleben kann – bis die Sonne aufgeht. Das Buch ist 1978 erschienen und zählt zu den „Klassikern“ der textlosen Bilderbücher.
- Beatrice Rodriguez: Der Hühnerdieb, 2008, Das Zauberei, 2011, Das Hühnerglück, 2012, alle drei Peter Hammer Verlag
Die höchst unterhaltsame und rasante Trilogie beginnt mit der Entführung des Huhns durch den Fuchs. Die spannende Verfolgungsjagd durch Bär, Hase und Hahn endet mit einer herzerwärmenden Überraschung. Im zweiten Band "Das Zauberei" geht die Geschichte an genau diesem Punkt weiter. Der gehörnte Hahn macht eine wunderbare Entdeckung und wird am Schluss mit einem beglückenden Fund getröstet. Im dritten Buch "Das Hühnerglück" schließlich geht es um den Nachwuchs von Huhn und Fuchs, um eine große Enttäuschung und eine ebenso witzige wie überraschende Versöhnung.
- Aaron Becker: Die Reise, Gerstenberg 2015
Ein kleines Mädchen malt sich mit roter Kreide eine Tür an die Wand seines Kinderzimmers und flüchtet so aus dem tristen Alltag in eine Abenteuer-Märchenwelt. Immer wieder kann sie mit ihrem Stift das Geschehen der Geschichte beeinflussen und braucht am Ende aber doch die Hilfe eines neuen Freundes.
- Peggy Rathmann: Gute Nacht, Gorilla, Moritz Verlag 2015
Der Gorilla stiehlt dem Zoowärter auf dessen letzter Nachtrunde seinen Schlüsselbund und befreit seine tierischen Kollegen. Allesamt landen sie im Schlafzimmer des Wärters, wo eine erstaunte Ehefrau auf ihren Gruß hin ein vielstimmiges „Gute Nacht“ vernehmen muss. Das Buch ist schlicht illustriert, dennoch gibt es viele Details zu entdecken.
- Claude K. Dubois: Akim rennt, Moritz Verlag 2015
Dieses Bilderbuch, 2014 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis und dem Katholischen Kinderbuchpreis ausgezeichnet, erzählt in eindringlichen Kohlezeichnungen und ohne viel Text von dem kleinen Jungen Akim und seiner Flucht.
- Antje Damm: Was ist das? Gerstenberg 2009
"Was ist das?" – diese Frage wird hier gleich zweiundzwangzig Mal gestellt. Und jedes Mal gibt es höchst überraschende Antworten.So wird aus dem Gartenschlauch eine Schlange, aus dem Wollknäuel ein Schaf, … Alle Situationen regen zum Entdecken, Erzählen und Weiterfantasieren an.
- Elsa Klever: Fische im Wohnzimmer, Bibliothek der Provinz 2014
„Hab ich den Wasserhahn auch wirklich abgedreht?“– das fragt sich ein Mann während er im Urlaub in der Hängematte liegt und muss erkennen: „Nein!“ Inzwischen hat sich sein Haus in eine vergnügliche Unterwasser-Abenteuerwelt verwandelt.
- Ronan Badel: Der faule Freund, Peter Hammer Verlag 2015
So faul ist das Faultier, dass es nicht einmal merkt, wie der Baum abgesägt wird, an dem es hängt, und es auf einen Transporter verladen wird. Die Freunde sind schockiert und die Schlange beschließt, den Schläfer zu retten.
- Torben Kuhlmann: Maulwurfstadt, NordSüd Verlag 2015
Am Anfang lebt ein einzelner Maulwurf tief unter einer grünen Wiese. Doch durch die immer größer werdende Zahl an Maulwürfen erfolgt ein rasanter Ausbau der Maulwurfstadt bis kein Fleckchen Grün mehr übrig ist. Das hochaktuelle Thema wird aufwändig und tiefgründig erzählt.
- Germano Zullo: Wie die Vögel, Aladin Verlag 2013
Dies ist die kleine Geschichte von einem Mann, der mit einem Laster voller Vögel aufs Land fährt und sie in die Freiheit entlässt. Einer jedoch bleibt sitzen und muss erstmal das Fliegen lernen. Es geht in diesem wunderbaren Buch um Selbstvertrauen, Hilfsbereitschaft, Vertrauen und den Beginn einer Freundschaft.
- Andrea Hensgen: Der große Hund, Peter Hammer Verlag 2011
Ein kleiner Bub muss sich auf seinem Schulweg ziemlich fürchten bis eines Tages ein großer Hund vor dem Schultor auf ihn wartet und ihn von nun an begleitet. Diese Freundschaft macht aus dem kleinen Angsthasen einen selbstbewussten Buben, der sich auch um andere kümmern kann.
- Mandana Sadat: Mein Löwe, Peter Hammer Verlag 2012
Eigentlich wollte der riesige Löwe den kleinen Buben fressen, der da mitten in der Wüste alleine sitzt, doch als er dessen Tränen sieht, wird aus dem Hunger Mitgefühl und eine Freundschaft entsteht. In eindrucksvollen, kräftigen Farben werden hier die großen Emotionen transportiert.
- David Merveille: Hallo Monsieur Hulot, NordSüd Verlag 2013
Viel zum Lachen gibt es in 22 Bildergeschichten, die die ganze Poesie, den Humor und den subversiven Charakter dieser weltberühmten Figur von Jacques Tati zeigen. Doch auch wer Monsieur Hulot noch nicht gekannt hat, wird vom tollpatschigen Antihelden amüsiert sein.
- Alice Hoogstad: Das kunterbunte Monsterbuch, aracari verlag 2014
Wie schon in „Die Reise“ ermalt sich hier ein Mädchen seine Fantasiewelt. In einer Stadt, die nur aus schwarz und weiß besteht, bevölkern bald kunterbunte Monster die Straßen – bis der Regen kommt.
- Katy Couprie: Die ganze Welt, Gerstenberg Verlag 2014
Die Themenvielfalt dieses Buches – sie reicht von Mensch, Tier und Natur, Computer und Licht bis zu Verkehr und Formen – wird in der Vielfalt der Illustrationstechniken widergespiegelt. Details, Assoziationen oder Eindrücke des vorangegangenen Bildes werden aufgegriffen und weiterentwickelt: neue Geschichten entstehen.