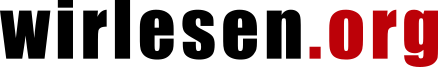1) Comics sind ein Türöffner in die Lesewelt
„Comics are a gateway drug to literacy.” – Art Spiegelman (Pulitzer-Preisträger, Autor von „Maus“)
Für Kinder mit Leseschwäche sind Comics der vielleicht beste Einstieg in die Welt der Literatur. Manche Kinder empfinden das Lesen von längeren Prosatexten als schwierig und mühselig. Bei ihnen stellt sich beim Schriftlesen kein befriedigender Lesefluss ein, kein inneres Bild – der berühmte „Film im Kopf“. Diesen Lesenden bieten Comics eine ausgezeichnete Leseplattform, denn die Bilder des Comics unterstützen sie bei der Lektüre und fungieren als visueller Anker für ihr Leseerlebnis. Sowohl die Anzahl als auch die Länge von Texten sind in Kindercomics überschaubar. Sie sind sogar optisch in ihren eigenen Sprechblasen und Textkästen abgegrenzt, was Kinder mit Leseschwäche zusätzlich motiviert, denn hier wird ein niederschwelliger Einstieg geboten. Man kann beim Comiclesen einfach einmal die Bilder sprechen lassen und visuell den Aufbau einer Geschichte nachverfolgen. So können auch schwache SchriftleserInnen anspruchsvolle Geschichten ohne Frustrationserlebnisse und auf einem Niveau lesen, dessen sie in reiner Schriftform noch nicht mächtig wären.
Gute Kindercomics sind meist intelligente und witzige Kurzgeschichten, die sich leicht und flüssig lesen lassen. Die Kinder können relativ schnell und auch einmal zwischendurch eine abgeschlossene Geschichte lesen. Man kann Comics auch seitenweise, also in kleinen Happen lesen, wieder weglegen und sich die Lektüre in Leseportionen einteilen. Diese Überschaubarkeit erlaubt einen weiteren niederschwelligen Zugang für schwache SchriftleserInnen. Comics bieten ihren Lesenden ein in sich geschlossenes Erzählsystem, in dem komplexe Erzählelemente sehr klar kommuniziert werden. Dass die gesprochene Sprache in den Sprechblasen steht, dass die Erzählstimme in Textkästen abgegrenzt ist, ist für viele Kinder intuitiv leicht erkennbar. Auch Kinder mit Leseschwäche können sich mit ansprechenden Kindercomics in relativ kurzer Zeit durch eine ganze Geschichte lesen und in einen befriedigenden Lesefluss kommen. Und wir wollen motivierte junge Leserinnen und Leser!
Das verwendete Vokabular in Kindercomics ist meist fortgeschritten, pfiffig und dabei auch kurz und bündig. So lernen Kinder, wie man verbal treffend und prägnant kommuniziert. Die Texte in einem gelungenen Comic müssen präzise wie auch hinreichend evokativ sein, damit sich der Comic letztlich auch ansprechend liest. Gute Comics sind eine Verbindung von Grafik-Design und Poesie: Jedes Wort muss innerhalb der Bildkomposition auch sitzen. Die Bilder des Comics veranschaulichen weiters die verwendeten Wörter und erklären bzw. definieren sie somit auf visueller Ebene. Zudem liefern sie Kontextinformationen und unterstützen dadurch auch das Lernen der Bedeutung neuer Wörter. So lernt man über mehrere Kanäle – nämlich verbal und visuell – die Bedeutung von unbekannten Begriffen – ein Umstand, der insbesondere beim Erlernen einer Fremdsprache von Vorteil ist.
Comicbilder vermitteln oft emotionale Gefühlszustände und Stimmungslagen durch die gezeichnete Mimik und Körperhaltung, wodurch Kinder die bildlich gezeigten Gesichtsausdrücke mit den sie beschreibenden Worten verbinden können. Beim Comiclesen deuten die Kinder weiters die dargestellten Gesichtsausdrücke selbst und lernen so, sich in eine Figur hineinzuversetzen. Comics schulen somit das empathische Einfühlungsvermögen, da man sich beim Comiclesen, so lange man möchte, auf ein einzelnes, unbewegtes Bild allein konzentrieren kann (im Gegensatz zum Film, der die Bilder in einer vorgegebenen Geschwindigkeit und mit Klang kombiniert ablaufen lässt).
2) Das Genussprinzip
Man kann niemand nachhaltig dazu zwingen, die Welt des Lesens zu betreten. Dafür ist die Leseentwicklung eine zu komplexe Angelegenheit. Zu einer Leserin/einem Leser wird man nur freiwillig. Einige Kinder lesen von sich aus gerne Comics. Kleinen ComicleserInnen kann auf ihrem Weg zur Bildung eigentlich nichts mehr passieren, denn in Wahrheit sind sie schon ein gutes Stück dieses Weges entlang gegangen – die Comics werden ihnen nach und nach die weite Welt des Lesens eröffnen. Eine potenzielle Gefahrenquelle lauert jedoch auf dem Bildungsweg junger ComicliebhaberInnen: Vermeintlich wohlmeinende Erwachsene, die den Umstand, dass die Kinder eben gerne Comics lesen, abwerten. Werturteile wichtiger Bezugspersonen beeinflussen Kinder – insbesondere, wenn es um so eine intime und komplexe Angelegenheit wie die der Leseentwicklung geht. Dann lassen die beschämten Kinder das mit dem Lesen aber vielleicht ganz bleiben.
Das Vorurteil, dass Comiclektüre die Kinder für das Lesen von Prosa „verbilde“, ist unterschwellig immer noch latent vorhanden – es konnte aber noch nie bestätigt werden. Die Erfahrung zeigt vielmehr, dass begeisterte junge Comiclesende später keinerlei Schwierigkeiten mit längeren und komplexen Schrifttexten haben. Dazu genügt es, den Blick nach Frankreich zu richten, wo Comics fester Bestandteil der Alltagskultur sind und – in breiter Auswahl in den meisten Haushalten – auch von vielen Erwachsenen gelesen werden. Ich denke nicht, dass die große Comicliebe der französischen Bevölkerung der Qualität des literarischen Outputs des Landes geschadet hat. Eltern und Lehrende sollten den Kindern also unbedingt die Freude an der Comiclektüre lassen, sie, wenn möglich, aktiv begleiten und für eine spannende Auswahl sorgen.
3) Visuelle Bildung
Gute Comics werden durchaus mehrmals gelesen. Zuerst lesen die Kinder die Geschichten meist recht flott, um die Handlung aufzusaugen. Beim zweiten oder dritten Mal wird der Comic aufmerksamer und langsamer erkundet – eine Art Gourmetlesen. Dabei können die Kinder vermehrt Einzelheiten und visuelle Erzähltricks bemerken und sich so auch der Autorenschaft einer Erzählung bewusst werden. Die Kinder lernen so auf ganz natürliche Weise Detailbewusstsein und kritisches Denken.
Bilder sagen angeblich mehr als tausend Worte. Ein gutes Bild kann die Art und Weise, wie wir über die Welt denken, nachhaltig beeinflussen. Eine talentierte Comicerzählerin/ein talentierter Comicerzähler kann aus einem Bild mehrere komplexe Ideen destillieren, die von ihren LeserInnen dann individuell interpretiert werden. Mittels der unbewegten Bilder eines Comics ist es möglich, bereits mit den Jüngsten Bildanalyse zu betreiben. Man kann die Kinder auf die Vieldeutigkeit von Bildern aufmerksam machen und ihnen die visuellen Manipulationsmöglichkeiten zeigen, mit denen alle Bildmedien – Comics, Film und Fotografie – arbeiten. Ein gutes Instrument also, um bereits sehr früh ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wir durch visuelle Informationen beeinflusst werden. Durch Computer, Smartphone, Printmedien und Außenwerbung werden wir täglich mit hunderten Bildern konfrontiert. Die Fähigkeit, visuellen Informationen gegenüber auf kritische Distanz gehen zu können, ist Grundstein für eine visuelle Bildung, die in unserer Welt zunehmend wichtiger wird.
4) Kognitive Komplexität
„There´s nothing in the medium that prevents it from being sophisticated.“ – Francoise Mouly (Redakteurin des New Yorker, Herausgeberin von Toon Books und „Raw“)
Comics setzen, was das Lesealter betrifft, meist dort an, wo das klassische Bilderbuch aufhört. In Comics wird das Prinzip Bildgeschichte jedoch auf ein wesentlich komplexeres Niveau gehoben: ComicleserInnen navigieren selbstständig durch die vielen Bilder auf einer Comicseite und stellen sinnstiftend die Verbindungen zwischen den Einzelbildern her. Ein interaktives Medium, bei dem die einzelnen Bilder unbeweglich auf der Seite bleiben und die LeserInnen selbst erst das Handlungsgeschehen zwischen den Bildern konstruieren müssen, in dem sie sich durch die Architektur einer Seitenkomposition bewegen. Und genau diese mentale Aktivität – die Induktionsleistung, das Schlussfolgern und das Herstellen von Verbindungen – ist etwas, das Kinder permanent machen: kleine PhilosophInnen, die konstant versuchen, die Welt um sie herum zu verstehen. Bei der Comiclektüre ist genau diese Eigenschaft gefragt. Die Einzelbilder eines Comics sind letztlich nur die gewählten Ausschnitte, die uns die AutorInnen zeigen – gleichsam Fenster, durch die wir in die Handlung hineinsehen können. Die eigentliche Handlung selbst findet dann erst in unseren Köpfen statt.
Wer Comics flüssig lesen kann, kann ja bereits Texte lesen. Eine Comicleserin/ein Comicleser kann darüber hinaus aber auch Texte in Kombination mit Bildfolgen lesen – eine besondere Lesefähigkeit, die im deutschen Sprachraum im Erwachsenenalter nur von einer Minderheit beherrscht wird. VielleserInnen, die mit Genuss mehrere anspruchsvolle Romane im Monat lesen, sind deswegen noch nicht notwendigerweise auch flüssige LeserInnen anspruchsvoller Erwachsenencomics. Denn Comiclesen ist ein spezifisches Können, eine eigene Kulturtechnik, die vermittelt, erlernt und geübt werden will. Und erst wer diese Fähigkeit beherrscht, kann dann auch in den Lesegenuss moderner Graphic Novel-Klassiker wie Joann Sfars „Die Katze des Rabbiners“, Hugo Pratts „Corto Maltese“ oder Ulli Lusts „Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens“ kommen. Comiclesen sollte demnach nicht nur als sinnvolle Unterstützung zum Erlernen des Schriftlesens im Kindesalter betrachtet werden. Comics lesen zu können ist eine eigenständige Kompetenz, die in der Leseförderung hinreichender Selbstzweck ist.
„Wenn ich mich entspannen will, lese ich Engels. Steht mir der Sinn nach Ernsthaftem, lese ich ‚Corto Maltese‘.“ Umberto Eco
Links
Dieser Text verwendet Auszüge aus Interviews mit Francoise Mouly (http://www.toon-books.com/) und Artikeln von der Leseförderungseinrichtung Eventilator (http://www.eventilator.de/comic-und-lesefoerderung.html) und Stiftung Lesen (https://www.stiftunglesen.de/service/publikationen-und-materialien/material-jugend/1379/). Mit Dank an Jörg Vogeltanz für seine Korrekturen.
Sebastian Broskwa ist Gründer des Comicvertriebs Pictopia in Wien.
Mai 2018