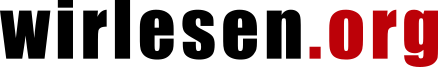Wie in einem Theater spielt sich während der Planung und Durchführung eines Vermittlungsangebotes aber mehr ab, als sichtbar ist. Um zu beschreiben, was qualitative Literaturvermittlung ausmacht, ist es unabdingbar, auch einmal einen Blick hinter „die Kulisse“ zu werfen.
Wozu Literaturvermittlung?
Dass Lesen und Literacy unverzichtbare Kompetenzen sind, ist unbestritten. Literatur und Kunst sind Kulturschätze, die entdeckt, bewahrt, reflektiert und weiterentwickelt werden wollen. Wir alle wissen, dass das Lesenlernen und die Auseinandersetzung mit Kunst herausfordernd und anstrengend sind und Motivation und Anreize benötigen.
Um Kinder dabei zu unterstützen, sich selbstbestimmt auf diese Aufgabe einzulassen, kann Kinderliteratur vermittelt werden. Dazu braucht es professionelle Angebote in einer anregungsreichen Umgebung, die Begeisterung für Kinderliteratur, Authentizität und viele Anknüpfungspunkte, um jedes Kind in seiner Individualität zu erreichen.
Literaturvermittlung hat über die Leseförderung hinaus den Anspruch und das Potenzial, Sprachförderung, Kunst- und Kulturvermittlung, Partizipation, Demokratisierung und vieles mehr zu vereinen. Auf dem Weg zum Lesen-Wollen werden staunend neue Welten entdeckt, kritische Fragen aufgeworfen und der Bezug zum eigenen Leben hergestellt. In den Vermittlungsstunden wird Kunst betrachtet und ausprobiert, es ist Raum zum Sprechen und Zuhören, Denken und Staunen, Fühlen und Erleben, Erproben und Scheitern, …
Wer vermittelt Kinder- und Jugendliteratur in Österreich?
Mit Literaturvermittlung beschäftigen sich viele Menschen, meist im Rahmen ihres Berufes: PädagogInnen in Schulen und Betreuungseinrichtungen, KinderbuchautorInnen und IllustratorInnen, BuchhändlerInnen, BibliothekarInnen oder Ehrenamtliche als VorlesepatInnen. Der BVÖ, das Bibliothekswerk, die Bibliotheksfachstellen und die pädagogischen Hochschulen bieten dazu und zu Leseförderungsprogrammen immer wieder Fortbildungen an.
Kunst der Vermittlung: Kinderliteratur
Das Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl bot von 2016–2018 den Pilotlehrgang „Kunst der Vermittlung: Kinderliteratur“ an und damit auch erstmals in Österreich eine zertifizierte Ausbildung zur Literaturvermittlung. Die ersten 10 Absolventinnen aus ganz Österreich und Südtirol erhielten im Jänner 2018 ihre Zertifikate.
Die Professionalisierung der Vermittlung ermöglicht eine Aufwertung der oft aufwendigen Arbeit, die hinter solchen Projekten steckt. Steigende Qualität und Quantität der Angebote sowie Weiterbildungs- und Schulungsmöglichkeiten für alle in diesem Feld Tätigen gehören zu den Vorhaben der „frischgebackenen“ Literaturvermittlerinnen. Derzeit wird am Aufbau einer Plattform und eines österreichweiten Netzwerkes für Literaturvermittlung gearbeitet, das den Zugang zu Vermittlungsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten erleichtern möchte.
Wo finden Vermittlungsangebote statt?
LiteraturvermittlerInnen kommen in Schulen, Bibliotheken, Betreuungseinrichtungen, aber auch in Parks, Stadtsäle, oder Freibäder. Überall, wo ihre Zielgruppen, also Kinder und ihre Eltern und interessierte Erwachsene sind, können Angebote gestaltet werden.
Wie funktioniert Literaturvermittlung?
Ziel der Literaturvermittlung ist es, neugierig zu machen, Zauber und Staunen zu ermöglichen, also nicht nur die kognitive, sondern auch die emotionale Ebene anzusprechen: Was mich berührt, beschäftigt mich - und damit setze ich mich auseinander. Diese Auseinandersetzung mit Literatur, Kunst und Büchern soll mit verschiedenen Angeboten angestoßen werden.
Zugänge zur Literaturvermittlung gibt es so viele wie Menschen, die sich damit beschäftigen.
Zu Beginn steht in den meisten Fällen ein bestimmtes Buch oder ein Thema. Um andere zu begeistern, ist die eigene Begeisterung für ein Buch der erste Schritt, denn vor allem Kinder lassen nur authentische Begegnungen gelten.
Was berührt mein eigenes inneres Kind?
Manche Bücher begeistern schon auf den ersten Blick, andere brauchen noch einen zweiten oder dritten Versuch. Bei Bilderbüchern kann der Text oder die Illustration allein packend sein oder es ist die Bild-Text-Interdependenz, die besonders anspricht.
Zur Beschäftigung mit dem Buch gehört neben dem genauen Betrachten und Lesen auch, den Kontext des Buches anzusehen: Informationen über AutorInnen und IllustratorInnen und deren Zugänge und Techniken und intermediale Bezüge erweitern den eigenen Horizont und auch den Blickwinkel auf das Buch und seine Entstehung.
Der nächste Schritt ist die Frage, wie ein Dialog möglich werden kann: Welche Details fallen auf, welche sind für Kinder wichtig, was finden sie spannend?
Es gibt viele erprobte Möglichkeiten, wie eine Literaturvermittlungseinheit ablaufen kann. Wichtig ist es, für die jeweilige Gruppe bzw. Einheit passende Methode zu finden oder kreativ zu werden und eigene zu erfinden, die die Kinder anspricht.
Wichtig ist auch die Überlegung, welche Materialien verwendet werden. Es soll ein Erfahrungsraum entstehen, der alle Sinne anspricht und der die Geschichte vielfältig widerspiegelt, so dass für die individuellen Bedürfnisse der Kinder einer Gruppe Anknüpfungspunkte oder Reibungsflächen geschaffen werden.
Unumgänglich ist die Beschäftigung mit den Rahmenbedingungen. Wie groß ist die Gruppe, wie alt sind die Kinder, welche besonderen Bedürfnisse oder Wünsche sind zu erfüllen? Ebenso wichtig sind räumliche und finanzielle oder personelle Besonderheiten.
Ideen und Tipps zur Vermittlung finden sich im Ideenportal oder bei den LiteraturvermittlerInnen (siehe unten).
Weiterführende Literatur und Links:
- Lehrbuch Literaturpädagogik. Stephanie Jentgens, Beltz Juventa 2016.
- Neue Leserezepte. Maria Theresia Rössler, Gudrun Sulzenbacher; Tyrolia 2016.
- Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl
- Homepages einiger Literaturvermittlerinnen:
Kathrin Hömstreit ist Literaturvermittlerin, Sozialpädagogin und ehrenamtliche Bibliothekarin. In ihrer Arbeit im Kindergarten und in der Bibliothek veranstaltet sie regelmäßig Literaturvermittlungseinheiten und Buchstarttreffen und bietet seit 2018 auch Workshops und Fortbildungen für Schulen, Kindergärten und Bibliotheken in Niederösterreich und Wien an.
Mai 2018