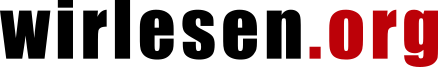„Wer ist dieses Wesen mit schrecklichen Klauen / und schrecklichen Zähnen, um Tiere zu kauen?“ (1) Die Ehre des finalen furchteinflößenden Auftrittes in diesen Text über Monsterfiguren in Bilderbüchern gebührt einem allein, dem Grüffelo. Mit „knotigen Knien“, einer „grässlichen Tatze“ und „vorn im Gesicht einer giftigen Warze“ (2) tritt er zwischen den Bäumen hervor, um der Maus buchstäblich das Fürchten zu lernen. Deren gewiefte Strategien sind mit dieser Begegnung einmal mehr gefordert. Waren es davor noch „reale“ Fressfeinde wie Fuchs, Eule und Schlange, so gilt es jetzt, der wahr gewordenen Imagination des denkbar furchtbarsten Monsters entgegen zu gehen. Mit der Maus wird eine Identifikationsfigur geboten, wir dürfen während des Leseprozesses gemeinsam mit der kleinen Protagonistin zittern, Ängste überwinden und am Ende des bestandenen Abenteuers ein paar Nüsse knacken.
„monstrare“ = auf etwas hinweisen
Guido van Genechten wählt einen sehr viel direkteren aber nicht minder vergnüglichen Weg der Monsterangstbekämpfung. „Das nächste Monster fängt nämlich fürchterlich an zu schreien, sobald du die Seite umblätterst. Na, traust du dich?“ (3) Unaufhörlich wird hier ein lesendes Du angesprochen, auf- und herausgefordert. „Zeig’s ihm. Schrei laut zurück. Lauter!“ (4) Seite für Seite entwickelt sich diese Geschichte zur gruseligen Mutprobe, zwischendurch werden Ausstiegsszenarien angeboten. „Traust du dich weiter? Du kannst auch jetzt aufhören, ich verrate es niemandem … (5) Wer sich bis zu Endes des Bilderbuches voran tastet, wird zum Schluss mit einer Tapferkeitsurkunde geehrt. Mutiges Durchhalten lohnt also auf jeden Fall! Über die große Bedeutung dieses Harrens bis zum (bitteren) Ende, können übrigens auch die beiden Geschwister in John Fardells „Der Tag, an dem Louis gefressen wurde“ ein Lied singen. Denn Louis wird wirklich von einem Monster gefressen. (Und zwar nicht nur von einem, um genau zu sein.) Zur Rettung aus dem Monstermagen kommt es dank seiner tapferen Schwester Sarah, die erstens ruhig bleibt, zweitens über das Fress- und Kauverhalten jener Monsterart Bescheid weiß („Sie wusste, das Schluckster ihre Beute normalerweise an einem Stück verschlingen.“ (6)) und drittens unglaublich flink und ausdauernd dem Monster mit dem Bruder im Bauch hinterherradelt.
Schenkt man der Herkunft der Worte „Monstrum“ bzw. „Monster“ Beachtung, werden zwei Hinweise auf die Verben „monere“, lateinisch für „mahnen“, sowie „monstrare“, „auf etwas hinweisen“, bedeutsam. – Wollen Monsterfiguren Identifikationsfiguren mahnen? Sie auf etwas hinweisen? Auf die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit persönlichen Ängsten vielleicht? So könnte auch Mehrdad Zaeris Mini-Keller-Monster in „Als Oma immer kleiner wurde“ gelesen werden. Inka Pabsts Text erzählt hier folgende Situation: „Manchmal gehe ich mit Oma in den Keller, um Kohlen für den Ofen heraufzuholen. Zum Glück ist Oma ja groß und fürchtet sich nicht im Kohlenkeller.“ (7) Die Illustration zeigt die Großmutter Kohle schaufelnd, dabei huckepack ein Mädchen tragend. Dessen Blick wendet sich in die Richtung des Kohlenberges, worauf ein Monster sitzt. Gerade durch die Nicht-Erwähnung im Text wird das Interesse auf diese Figur gelenkt, welche dem Mädchen direkt in die Augen blickt und ihm zuwinkt, während die Großmutter nichts ahnend schaufelt. Sieht das Kind hier seiner eigenen Angst in die Augen? Der Angst vor dunklen Kellerräumen? Oder der Angst davor, die Großmutter zu verlieren?
Wenn die Phantasie einen Streich spielt
Wie der Keller so ist auch der (nächtlich) dunkle Wald ein in der Literatur bewährter Ort für die, mittels furchteinflößender Figuren symbolisch in den Außenraum verlagerten, Ängste der dort agierenden Figuren. Der Hase Simon aus der Feder Stephanie Blakes ist übrigens nur deswegen des Nachts draußen unterwegs, weil sein kleiner Bruder Franz das Schmusetuch vergessen hat und ohne dieses nicht schlafen kann. Tapfer geht Simon dorthin zurück, wo die Brüder bei Tag gespielt haben und findet das Schmusetuch. Am Heimweg spielt ihm seine Phantasie bzw. die dann doch aufkommende Ängstlichkeit einen Streich: „Hat sich da etwas bewegt? Da, ganz nah in der schwarzen Nacht? Und als er sich umdreht … sieht er ein riesen mega giga MONSTER, das in fressen will.“ (8) Oder ist das Monster etwa echt? In jedem Fall dient es Simon, nach erfolgreichem Davonrennen und glücklicher Ankunft im Familienhaus, dazu dem Bruder den Rest der Nacht von seinem Abenteuer zu erzählen. Stephanie Blake inszeniert die Monsterfigur als eine in Wort und Bild sichtbar gemachte als auch wahr gewordene Phantasie Simons. Also eines Monsters, das im Sinne seiner eigenen Wortbedeutung auf das Innenleben des Protagonisten hinweist(!), jedoch im literarischen Außenraum Wald sichtbar wütet. (8)
Auf die kunstvoll sowie geschickt dargebotene Verschmelzung einer Monsterfigur mit dem sie umgebenden, völlig schwarzen Handlungsraum setzt Edouard Manceaus in der „Der wilde Watz“. Das hier im Text angesprochene Du ist das Monster selbst. „Huh! Du willst mich fressen, mit Haut und Haar, du WILDER WATZ! Aber du machst mir keine Angst! Ich kitzle dich an deinen Hörnern …“ (9) Wie bei Guido van Genechten ist für die Überwindung der Monsterangst auch eine aktive Teilhabe der Lesenden ausschlaggebend. Manceau lässt das Monster darüber hinaus – so zu sagen von der Geschichte selbst – in seine Einzelteile zerlegen bzw. dekonstruieren. Farbflächen, also konkrete Bestandteile der Illustrationen, werden nach und nach zu den Handlungsraum darstellende Requisiten. Die Füße des Monsters sind Bäumen, nachdem wir es gekitzelt haben, der Hals ein Haus und die Hörner bilden sich zum Halbmond. Ja, jetzt macht der durchgängig flächig schwarze Hintergrund richtig Sinn! Denn ein listiger Streich voll der Phantasie wie dieser, kann nur in solch einer dunkelschwarzen Nacht gelingen!
(1), (2) Axel Scheffler/Julia Donaldson: Der Grüffelo. Aus dem Engl. v. Monika Osberghaus. Weinheim: Beltz & Gelberg 1999.
(3), (4), (5) Guido van Genechten: Hier gibt’s Monster. Aus dem Niederl. v. Meike Blatnik. Berlin: Annette Betz 2017.
(6) John Fardell: Der Tag, an dem Louis gefressen wurde. Aus dem Engl. v. Bettina Münch. 5. Aufl. Frankfurt am Main: Moritz 2016.
(7) Inka Pabst/Mehrdad Zaeri: Als Oma immer kleiner wurde. München: Tulipan 2017.
(8) An dieser Stelle sei auf ein weiteres bedeutsames Werk zum Thema verweisen: Maurice Sendak: Wo die wilden Kerle wohnen. Aus dem Amerik. v. Claudia Schmölders. Zürich: Diogenes 1967.
(9) Stephanie Blake: Nein, tein heia! Aus dem Franz. v. Tobias Scheffel. Frankfurt am Main: Moritz 2017.
(10) Edouard Manceau: Der wilde Watz. Aus dem Franz. v. Markus Weber. Frankfurt am Main: Moritz 2017.