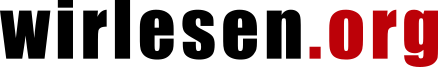Bei der Beantwortung dieser Fragen begegnet man zahlreichen undefinierten Aspekten, die hier als drei sogenannten Irritationen festgehalten werden.
- Zumeist betonen die Leitbilder, dass Bibliotheken einen freien Zugang zu Informationen und Medien bieten. In der Bibliothek können Menschen auf Medien zurückgreifen, die sie sich ökonomisch nicht leisten können. Es wird jedoch nicht erklärt, wie der freie Zugang zu Informationen Menschen in Armut helfen würde und wobei. Es ist nicht so, dass alles, was Menschen in Armut benötigen, um aus der Armut auszusteigen, mehr Informationen wären.
- Wenn wir uns die bibliothekarische Literatur und die Forschungen zur Bibliotheksnutzung ansehen, fällt auf, dass Menschen in Armut darin so gut wie nicht vorkommen. Bei all den Umfragen zur Nutzung von bibliothekarischen Angeboten wird fast nie nach der ökonomischen Situation gefragt. Um zu erkennen, wie und ob Bibliotheken für Menschen in Armut eine positive Wirkung haben können, sollte man verstehen, wie diese die Bibliotheken nutzen oder nicht nutzen. Bislang entstehen die meisten Angebote auf der Basis von Vermutungen.
- Es ist nicht einfach zu sagen, was Bibliotheken in Bezug auf Menschen in Armut tun sollen. Sollen sie möglichst wenig Barrieren bieten, so dass Menschen in Armut die Bibliotheken genauso nutzen können wie Menschen in anderen sozialen Situationen auch? Heißt das, dass man Barrieren aktiv identifiziert und angeht? Oder sie nicht neu zu errichten? Oder sollen Bibliotheken Menschen in Armut helfen? Aber dann: Wobei helfen? Beim Ausstieg aus der Armut oder beim Führen eines Lebens in Armut? Oder sollen sie dafür sorgen, dass der Rest der Gesellschaft darüber informiert wird, wie Menschen in Armut in unseren Gesellschaften tatsächlich leben? Diese Fragen gilt es zu stellen.
Was wir wissen
Obwohl wenig darüber bekannt ist, wie Menschen in Armut die Bibliotheken nutzen und wofür, weiß man hingegen recht viel darüber, wie Menschen in Armut in unseren Gesellschaften leben und welche Auswirkungen diese auf ihr Leben hat. Laut den Daten von Eurostat lebten 2015 in Österreich 1,55 Millionen Menschen oder 18,3% der Bevölkerung, in Armut. Es handelt sich also nicht nur um einige, wenige Fälle, denen man leicht irgendwie helfen könnte.
Was man über das Leben der Menschen in Armut weiß, ist unter anderem: Die meisten Menschen haben sich auf einem niedrigen finanziellen Niveau, unter Verzicht auf bestimmte zum normalen Lebensstandard zählende Dinge, eingerichtet. Arm sein heißt in unseren Gesellschaften auch, die ständige Erfahrung des Scheiterns zu machen. Erfolge durch Bildung kennen zu lernen, ist für Menschen in Armut nur in Ausnahmefällen möglich. Hinzu kommt, dass man wenig ökonomischen Spielraum hat, um Erfahrungen zu machen. Wer zum Beispiel das Geld für Museums- oder Konzertbesuche lange im Vorfeld planen muss, investiert es eher in schon bekannte Dinge und lernt vielleicht nie, was es noch alles für Möglichkeiten und Chancen gibt. Wir leben in einer meritokratischen Gesellschaft, die davon ausgeht, dass Menschen aufgrund ihrer Fähigkeiten und Anstrengungen ihre jeweilige soziale Position erreichen. Daraus ergibt sich auch, dass Lösungen für die Frage, ob jemand aus Armut aussteigen kann, in diesem System verortet werden. Man kommt zum Schluss, dass Menschen in Armut dazu angetrieben werden müssten, sich anzustrengen und Bildung, Bildung und noch mehr Bildung hilft. Das Ergebnis ist aber, dass Bildung als Lösung überbewertet wird, so dass jede Bildung als Lösung gilt und nicht mehr erläutert wird, wie spezifische Bildungsaktivitäten spezifischen Menschen in Armut genau helfen sollen. Über andere Gründe für Armut und folglich andere Hilfestellungen wird nicht mehr nachgedacht.
Vorschläge für Bibliotheken
Es lassen sich grundsätzlich drei Interessen von Menschen in Armut erkennen: Das Aussteigen aus der Armut, das Leben in Armut lebbar zu gestalten und die Chance, dass die eigenen Kinder nicht in Armut leben müssen.
Bibliotheken sollten sich darüber klar werden, was sie tun wollen. Wollen sie als verlässliche Institution die Menschen in Armut dabei unterstützen, ihr Leben in Armut besser lebbar zu gestalten, also zum Beispiel eine zugängliche Institutionen sein, auf die man sich verlassen kann? Wollen sie Informationen vermitteln, wie man dieses Leben besser führen kann, indem sie über Rechte gegenüber den zuständigen Ämtern beraten? Oder wollen sie Menschen in Armut dabei unterstützen, aus der Armut auszusteigen? Das würde dann aber auch heißen, zu klären, wie das funktionieren soll. „Zugang zu Information vermitteln“ oder „Bildung, Bildung, Bildung“ sind nicht immer sinnvollen Lösungen. Oder sollten Bibliotheken die Gesellschaft darüber aufklären, wie Menschen in Armut leben und die Sichtweise korrigieren, dass Betroffene aus eigener Anstrengung heraus aus der Armut aussteigen könnten?
Auf jeden Fall sollten sich Bibliotheken aktiv darüber informieren, wie Menschen in Armut leben und wie sie Bibliotheken tatsächlich nutzen. Das kann durch Forschungen zur Armut aus anderen Wissenschaftsfeldern geschehen, durch Erfahrungsaustausch mit anderen Bibliotheken oder durch den direkten Austausch mit Menschen in Armut. Bibliotheken scheinen am sinnvollsten zu handeln, wenn sie realistisch bleiben. Es ist für sie machbar, als Einrichtungen zu funktionieren, die das Leben von Menschen in Armut lebbar machen, insbesondere indem sie eine verlässliche Einrichtung darstellen. Bibliotheken als Einrichtung zu verstehen, die Menschen beim Ausstieg aus Armut helfen, scheint unrealistisch. Ebenso ist es wichtig festzuhalten, dass die Lösung für Armut nicht in der Macht der Bibliothek liegt, sondern eine politische Aufgabe ist.
Der Artikel ist die gekürzte Fassung eines Vortrages, den Sie in vollständiger Form hier nachlesen können.
Artikel mit freundlicher Genehmigung des Autors gekürzt von Martina Stadler