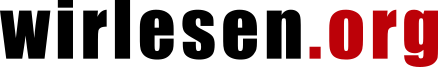„Wird der Mist hier auf einem Extra-Grill zubereitet oder zusammen mit Blattprodukten?“ (1) Wer das wissen möchte? – Die Schmeißfliege, ihres gleichen neuer Gast am Imbisstand des Hirschkäfers. Mit dieser Frage ist der Käfer jedoch mitnichten aus der Ruhe zu bringen. Denn am Hirschkäfergrill wird sorgsam und frisch serviert, die Buletten für die Mistburger werden selbstverständlich am Extra-Grill angerichtet. Neben gefüllten Ahornblättern und Rindengeschnetzeltem stehen auch mistfreie Menüs (2) im Angebot. Lesende, die Appetit auf vegetarisches oder auch veganes Essen haben, kommen in diesen vergnüglichen Vorlesegeschichten, die sich ebenso gut auch zum Selberlesen eigenen, voll auf ihre Kosten. Mittels unzähliger Anspielungen nimmt Constanze Spengler menschliches Essverhalten und Ernährungsgewohnheiten auf die Schaufel, ohne dabei auch nur mit einem Wort einen einzigen Menschen zu nahe zu treten. Denn ihre Geschichten handeln ausschließlich in der Welt der Insekten. Der zentrale Handlungsraum „Hirschkäfer-Grill“ dient als Ausgangs- sowie Ankerpunkt für ein witziges und spannendes Tier-Miniatur-Abenteuer. Fast so, als könnten sie auch auf der Speisekarte des Hirschkäfers stehen, klingen die (realen) Rezepte in Erin Gleesons vegetarischem Familienkochbuch. Egal ob Trauben-Brause, Lorbeerkartoffeln oder Rosmarin-Butterkekse – die Fotografin und Foodbloggerin setzt einfache, vegetarische Snacks, Hauptgerichte und Nachspeisen geschmackvoll als auch übersichtlich in Szene, sodass sie von und mit Kindern gut zubereitet werden können. (3)
Fleischfressende Vegetarier
Wird im Kochbuch großer Wert auf eine fotografisch-klare Darstellung von Nahrungsmittel gelegt, kann in Bilderbüchern die Thematik sehr viel sorgloser (und auch humorvoller) diskutiert werden. In der Rotisserie des Wolfes beispielsweise, wird der „Gackernde Kebab“, welchen Fuchs Ferdinand „fangfrisch, ungekocht“ (4) bestellt, direkt auf die Hand serviert. Ferdinand hält zwei Hälften Weißbrot in Händen, in deren Mitte ein ganzes, völlig erschöpft aber sehr lebendig aussehendes Hühnchen geklemmt wurde. Extra blutig, könnte man meinen, jedoch verfolgt der Fuchs mit seiner Bestellung keinesfalls kulinarische Ziele. Denn Ferdinand lebt vegetarisch, er liebt Schweizer Käse und Detektivgeschichten. Weil er jedoch seinen Papa stolz sehen möchte, entschließt er sich ein Huhn zu fangen. Claudia Boldt lässt den Protagonisten ihrer liebenswerten und flott sowie in aller Direktheit erzählten Geschichte eine wesentliche Frage formulieren: „Bin ich kein richtiger Fuchs, wenn ich keine Hühner mag?“ (5) Während Ferdinand mutig weiterhin entgegen den Überzeugungen seines Vaters entscheiden wird, behauptet sich ein anderer vegetarischer Bilderbuchheld ebenso tapfer inmitten seiner – auch von Natur aus fleischfressenden – Artgenossen. Der Tyrannosaurus namens T-Veg entkräftet bei Smriti Prasadem-Halls und Katherina Manolessou ein hartnäckiges Vorurteil: „Ein T-Rex, der braucht Fleisch, Fleisch, Fleisch. Denn Fleisch, DAS macht uns stark! Und frisst du nur Gemüsekram, das ist doch ALLES QUARK!“ (6) Die fortwährende Diskussion darüber, dass Fleisch Kraft gäbe, die bei pflanzlicher Ernährung fehle, wird in dieser gereimten Bilderbuchgeschichte ohne Umschweife und in kräftig-leuchtender Farbigkeit erzählt. T-Vegs Ernährung ist abwechslungsreich. Er liebt sämtliche Gemüse- und Obstsorten gleichermaßen. Dahingegen fällt die Lebensmittelvielfalt in der Höhle der Yets weit weniger breit aus. In Eva Sussos und Benjamin Chauds Bilderbuch findet sich neben Blaubeeren und einigen Tannenzapfen nur noch eine Ziege. Bei „Yeti Pleki Plek“ dient die Thematik des Vegetarismus dem Spannungsaufbau. Denn die beiden Brüder, welche sich im verschneiten Winterwald verirrt hatten, von einem Yeti gefunden und kurzerhand in dessen Höhle geschleppt wurden, ahnen vorerst nichts Gutes. Schließlich ist der Yeti hungrig, „er klopft sich auf den Bauch. ‚Gormy gurmy gally Späck – Yeti Pleki Plek!‘, raunt er.“ (7) Diese Worte des bärenhaften Riesenwesens klingen einerseits ganz klar nach Magenknurren und einem allseits bekanntem Fleischgericht, könnten jedoch andererseits auch ausschließlich als Hunger bekundendes Wortspiel gelesen werden. Bange fragt der jüngste der beiden Buben: „Wird er uns jetzt auffressen?“ Worauf der Ältere ganz salopp sein Wissen preisgibt: „Ach was, Yetis sind doch Vegetarier.“ (8) Und auch große Feinschmecker, mit Vorliebe zu frisch gemolkener Ziegenmilch. Auch die Blaubeer-Tannenzapfensuppe duftet köstlich!
Gewissensfrage
Yetis die kein Fleisch essen, Dinosaurier, deren Kräfte vom vielen Obst und Gemüse stammen und Füchse, die Hühner-Kebab bestellen, ohne Hühnchen zu mögen – verschiedenste Geschmäcker treffen auf unterschiedlichste Überzeugungen! Wie gut, dass Alexandra Maxeiner und Anke Kuhl in ihrem humorvollen aber ebenso informativen Sachbuch über das Essen Klarheit schaffen:
„Menschen, die kein Fleisch und keinen Fisch essen, heißen Vegetarier. Manche essen kein Fleisch, aber Fisch. Sie heißen Pescetarier. Manche essen kein Fleisch, keinen Fisch, kein Ei, keine Butter und keinen Honig. Also nichts, was von oder aus einem Tier gemacht wird. Sie heißen Veganer. Jakob isst kein Fleisch, außer Würstchen. Wurstianer nennt er sich.“ (9)
Etwas andersrum gedacht, bedient sich Tobias Krejtschi im Pappbilderbuch „Monstermampf“ der Wurst-Thematik. Während all jene Nahrungsmittel, die hier von gierigen aber äußerst sympathischen Monstern verspeist werden, allesamt vegetarisch sind, bleibt unklar, was das Wurst-Monster gerade gefressen hat. Fest steht nur, dass dieses am letzten Bild zufrieden auf der Toilette sitzt. Unter der Klappe in Form der Klomuschel, findet sich ein Würstchen. (10) Die Diskussion rund um ethisch korrektes Essverhalten wird hier außen vor gelassen und auch, bedingt durch die junge Zielgruppe, keinesfalls erwartet. Sehr unverblümt nähern sich dahingegen Hermann Schulz und Wiebke Oeser der Frage nach dem Gewissen jenen Lebewesen gegenüber, die getötet, um von anderen gegessen zu werden. Während die Gäste auf der Terrasse des Fisch(!)restaurants empört den beiden Anglern am Steg entgegenrufen: „Werft den Fisch wieder ins Wasser! Das kann man ja nicht mit ansehen, diese Tierquälerei!“ (11), fühlen Lesende sowie Vorlesende mit den beiden, die bereits das Messer in der Hand halten. Das Bilderbuch „Mein erster Fang“ erzählt von Eigenverantwortung, von bewussten Entscheidungen aber auch davon das zu essen, was die Natur der unmittelbaren Umgebung bietet. Übrigens: Auch an Hirschkäfers Imbissstand wird auf Regionalität der Lebensmittel geachtet. Der Mist für die Burger stammt selbstverständlich frisch von der Kuhweide um die Ecke.
- Constanze Spengler: Willkommen im Hirschkäfer-Grill. Hamburg: Aladin 2017. S. 45.
- Vgl. Ebda, S. 19, 82, 99.
- Erin Gleeson: Ein Fest im Grünen für Kinder. Einfach, vegetarisch, bunt für kleine Genießer. Aus dem Engl. v. Helmut Ertl. München: Knesebeck 2016.
- Claudia Boldt: Ferdinand Fuchs frisst keine Hühner. Aus dem Engl. v. Birgit Franz. München: Prestel 2016.
- Ebda.
- Smriti Prasadem-Halls/Katherina Manolessou: T-Veg. Der fürchterliche Früchte-Fresser. Aus dem Engl. v. Kathrin Köller. München: Prestel 2017.
- Eva Susso/Benjamin Chaud: Yeti Pleki Plek. Aus dem Schwed. v. Karl-Axel Daude. Münster: Bohem 2015.
- Ebda.
- Anke Kuhl/Alexandra Maxeiner: Alles lecker! Von Lieblingsspeisen, Ekelessen, Kuchendüften, Erbsenpupsen, Pausenbroten und anderen Köstlichkeiten. Leipzig: Klett Kinderbuch 2012.
- Vgl.: Tobias Krejtschi: Monstermampf. Bargteheide: Minedition 2017.
- Herman Schulz/Wiebke Oeser: Sein erster Fisch. Weinheim: Minimax bei Beltz & Gelberg 2016.