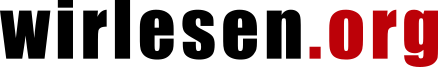Derzeit befinden sich Bücher in 44 Sprachen im Bestand, in denen Kinder und Jugendliche schmökern und lesen können (siehe Sprachenliste). Dazu ergänzend laden Veranstaltungen wie z.B. mehrsprachiges Geschichtenerzählen, Bilderbuchkinos, Workshops, Puppentheater, Kamishibai-Theater etc. dazu ein, Literatur in verschiedenen Sprachen interkulturell zu erfahren und unmittelbar zu erleben. Darüber hinaus liegt ein großer Schwerpunkt darauf, die Mehrsprachigkeit, welche die Kinder in die Bibliothek mitbringen, im Rahmen von Leseanimationen aufzugreifen und zu thematisieren. Dabei geht es weniger darum, in mehreren Sprachen zu sprechen als vielmehr darum, als Bibliothekarin oder Bibliothekar die Kinder zu ermuntern, sich mit den verschiedenen Sprachen auseinanderzusetzen. Dies geschieht in einer gemeinsamen Sprache (meistens Deutsch). Eine besonders wirksame Methode ist es, die Kinder zu Sprachexpertinnen und Sprachexperten für ihre Sprachen zu ernennen – eine Rolle, in die sie motiviert schlüpfen, weil sie gerne zeigen, was sie alles wissen und können.
Jede Sprache ein Märchen
Die Kinderbücherei der Weltsprachen hat sich bereits innerhalb des ersten Jahres zu einer erfolgreichen Plattform für neue Ideen, Konzepte oder Projekte entwickelt. Das Team in der Zweigstelle, geleitet von Majda Kovacevic, arbeitet motiviert daran, mit dem Schwerpunkt der interkulturellen Bibliotheksarbeit breit und niederschwellig nach außen aufzutreten, was immer wieder neue Kooperationswege eröffnet. Eine der herausragenden Kooperationen im vergangenen Schuljahr war die Veranstaltungsreihe „Jede Sprache ein Märchen“ – ein mehrsprachiges Leseförderprojekt, das in Zusammenarbeit mit der Leiterin des Referates Bibliothekspädagogik Magdalena Zelger und einer dritten Volksschulklasse der „Marie Jahoda Schule“ in Wien entstanden ist. Monatlich besuchten Kinder der genannten Klasse gemeinsam mit ihrem Lehrer die Bibliothek und gestalteten das Projekt aktiv mit. Basierend auf der Heterogenität der Klasse - zu dem Zeitpunkt waren insgesamt zehn verschiedene Sprachen vertreten - wurde das Projekt konzipiert und erstreckte sich über den Zeitraum von November 2015 bis Juni 2016.
Im Mittelpunkt des Projektes standen Märchen aus verschiedenen Ländern. Die Ausgangsidee bestand darin, mit Kindern das Thema Märchen im Hinblick auf seine Kultur, Tradition und seine Merkmale nicht nur im Unterricht zu erarbeiten. Vielmehr sollte ergänzend dazu die Kinderbücherei der Weltsprachen als ein lebendiger Begegnungsort mit Märchen in vielen Sprachen und aus unterschiedlichen Regionen erfahren werden. Jede Einheit widmete sich einem Märchen in seinem Originaltext. So wurden Märchen aus dem bosnischen/kroatischen/serbischen-Sprachraum, dem arabischen Sprachraum, aus Polen und der Türkei in der jeweiligen Sprache und auf Deutsch dialogisch vorgetragen und anschließend mit einer kleinen Aktivität, in der die Kinder das Märchen vertiefen konnten, abgerundet. Das Prinzip beim Vorlesen gestaltete sich folgendermaßen: Die gesamte Handlung oder einzelne Passagen daraus wurden entweder in zwei Sprachen parallel oder intersprachlich (abwechselnd in der einen und in der anderen Sprache) erzählt. Einige Kinder beteiligten sich ebenfalls an der Wiedergabe und machten erste Erfahrungen in dieser Rolle. Sie lasen Textpassagen aus dem Märchen in ihrer Erstsprache zum ersten Mal vor der gesamten Klasse vor, was vom Publikum sehr positiv aufgenommen wurde.
Die Kinder sahen sich während des gesamten Projektes vor die Herausforderung gestellt, Entdeckungen zu machen und diese mit anderen Kindern zu teilen. Besondere Momente für alle Beteiligten ergaben vor allem Situationen, wo ihre Begeisterung zu spüren war – sei es, dass sie zum ersten Mal Märchen in ihrer Erstsprache hörten, sei es, als sie miterlebten wie Ali Baba „Sesam, öffne dich“ in seiner Sprache sagte oder wie leicht und schnell sie Zaubersprüche in anderen Sprachen lernen konnten oder zu der Erkenntnis gelangten, dass sich auch viele Gemeinsamkeiten entdecken lassen (z.B. dass es Sultane auch in Europa gab, wo sie allerdings Könige oder Kaiser hießen) oder, dass sie von manchen fremden Sprachen doch einige Wörter verstehen oder sagen konnten.
Erfahrungen in der Kinderbücherei der Weltsprachen haben gezeigt, dass das Konzept Mehrsprachigkeit in Literacy-Aktivitäten vielfältige Chancen für die Bibliothek und ihre Leserinnen und Leser bietet. Der Ansatz erwies sich in der Praxis als Quelle für intensiven Austausch, regte die Sprachreflexion an und forderte zum interkulturellen Lernen heraus. Kinder werden durch mehrsprachige Kinderliteratur an die Bildungssprache herangeführt, in der sprachlichen Identität gestärkt und in ihrer sprachlichen und kognitiven Entwicklung gefördert. Und schließlich besitzt der mehrsprachige Ansatz auch das Potenzial, alle Kinder, sowohl jene mit deutscher als auch jene mit nichtdeutscher Familiensprache, zu erreichen. So nutzten Kinder mit Deutsch als Erstsprache die Gelegenheit über ihre Dialekte zu sprechen oder andere Sprachlernerfahrungen mit der übrigen Gruppe zu teilen. Mit der institutionellen Förderung der Mehrsprachigkeit stellen sich die Büchereien Wien der sprachlichen Vielfalt der Wiener Bevölkerung und setzten ein klares Zeichen der Anerkennung dieser als einer wichtigen Ressource für den Einzelnen und die Gesellschaft.
Hier finden Sie eine Liste des Medienbestands nach Sprachen gereiht.
Hier kommen Sie zur Kinderbücherei der Weltsprachen.
Literatur:
- Gawlitzek, Ira/ Kümmerling-Meibauer (Hrsg.): Mehrsprachigkeit und Kinderliteratur. Fillibach bei Klett: Stuttgart 2014.