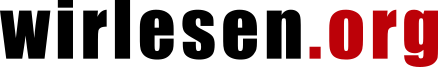Einzelne Gedanken formen sich manchmal zu einer Geschichte. Manche Geschichten werden aufgeschrieben oder gezeichnet. Einige dieser zu Papier gebrachten Texte oder Bilder sind später Bücher. Aus Gedanken werden also Bücher, das klingt einfach. Aber: Was braucht es, damit Geschichten – oder auch Gedichte, Sachinformationen, usw. – in Form eines Buches greifbar werden? Wie kommt das, was jemand erzählen, erklären oder zeigen möchte, zwischen zwei Buchdeckeln?
Ideenfindung
Fast ganz zufällig wird im Jugendbuch „Wie ganz zufällig aus meinem Leben ein Buch wurde“ aus Erlebnissen, Erfahrungen und Überlegungen der 13-Jährigen Katinka ein Buch. Diese Titel gebende Behauptung funktioniert in Annet Huizings Jugendroman in mehrfacher Hinsicht: Die Ich-Erzählerin Katinka möchte gerne Schriftstellerin werden und bittet daher die Nachbarin und Autorin Linda um Hilfe. Während Linda dem Mädchen wertvolle Schreibtipps vermittelt und Texte kommentiert, erleben wir, wie sich rund um diese Szenen langsam ein Roman entwickelt. Denn Katinka erzählt autobiografisch. Dabei erfahren wir nicht nur die Ereignisse rund um die erzählte Gegenwart der beiden Frauen, sondern auch jene Texte, die Katinka Linda zu lesen gibt. Rückblenden kommen zum Einsatz, Zeit wird beschleunigt, Situationen werden bildhaft beschrieben und Einzelheiten hervorgehoben. „‘Verwende konkrete Details‘, sagte sie. ‚Damit erzählst du etwas über deine Figur.‘“ (1) „Show, don’t tell!“ – So lautet ein Schreibtipp Lindas, der mit acht weiteren Anregungen auch auf der ersten Seite des leeren, dem Roman beigelegten, Notizheftes zu lesen ist.
Eine ebenso deutliche Aufforderung zum Konkretisieren eigener Ideen haben Renate Habinger und Verena Ballhaus mit ihrem Sachbilderbuch „Kritzel & Klecks“ (2) entwickelt. Während Annet Huizing Schreibbeginne unterstützt, begleiten die beiden Illustratorinnen Zeichen- und Malprozesse, indem sie beispielsweise in Schritt-für-Schritt-Anleitungen verraten, wie die beiden Figuren des Buches entstanden sind. Ein- und Rückblicke rund um die Entstehung seiner bekanntesten Protagonisten ermöglicht auch Svend Nordqvist. Er veröffentlicht ein Skizzenblatt, auf welchem sich erstmals ein alter Mann mit Bart und Hut sowie ein Kater einfinden und gibt damit Einblicke in seine Art der Ideenfindung. (3)
„Die besten Einfälle habe ich immer im Park. Gerade sitze ich auf meiner Lieblingsbank und denke über meine neue Idee nach.“ (4), erzählt die fiktive Kinderbuchautorin Petra Fuchs in Daniel Napps Bilderbuch „Das schlaue Buch vom Büchermachen“. Petra berichtet dem Kinderbuchillustrator Julius Dachs von ihrer Idee, gemeinsam entwickeln sie die Geschichte weiter und präsentieren diese auf der Frankfurter Buchmesse einigen Verlagen. Daniel Napp gibt allen am Schreib-, Zeichen- und Herstellungsprozess Einbezogenen einprägsame Charaktere und veranschaulicht leicht nachvollziehbar die einzelnen Schritte von der Idee im Park bis hin zum Buch als Kindergeburtstagsgeschenk.
Herstellung
Wie auch bei Daniel Napp treten im Sachbuch „Das geheime Leben der Bücher“ Herstellerin, Verlegerin, Drucker und andere Beteiligte persönlich auf. Während im Bilderbuch die Aufgaben aller, mitsamt der einzelnen Stufen der Herstellung, anschaulich zusammengefasst werden, holen die MacherInnen des Sachbuches weiter aus. Hier erläutern die AkteurInnen konkrete Aufgaben und geben sachlich-informativ sowie assoziativ Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Während die Herstellerin notiert: „Ich habe immer beides im Blick: die Schönheit und die Kosten.“ (5), hat der Verlag keine Ausgaben und Mühen gescheut, nicht nur inhaltlich, sondern auch haptisch zu zeigen, wie viele Einzelheiten dieses Buch zu dem machen, das wir letztendlich in Händen halten. Die letzten Seiten werden beispielsweise auf gestrichenem Papier gedruckt, anhand dessen die farblichen Unterschiede zum Naturpapier auf den Seiten davor nachvollzogen werden können. Am Buchrücken sind mittels eines „Fensters“ in der Buchdecke, gebundene sowie geklebte Bögen sichtbar. Buchbinder- als auch Herstellerinnenfigur erläutern begeistert, wie es dazu kommen konnte.
Wie es überhaupt zu alle dem kommen konnte, berichtet John Agard, indem er ganz am Anfang der Buchgeschichte zu erzählen beginnt: „Lange vor dem Buch war der Atem.“ (6) – Um jene ersten Atemzüge zu dokumentieren, beginnen die Menschen Ereignisse mittels Zeichen festzuhalten. Die Zeichen werden konkretisiert, mit den Jahrtausenden standardisiert, die Materialien, auf denen sie niedergeschrieben werden, entwickeln sich parallel dazu. John Agard erzählt anschaulich-einfach aber niemals banal und steigert durch seine durchdachten Auseinandersetzungen den Wert des „Gegenstandes“ Buch in unseren Köpfen, während wir ein in Halbleinen gebundenes, von Neil Packer stimmungsvoll in schwarz-weiß illustriertes Buch in Händen halten. Der Protagonist eines längst populär gewordenen Bilderbuches zu genau diesem Thema würde dazu klar und deutlich ergänzen: „Das ist ein Buch!“. (7) Ein echtes Buch, mit richtigen Seiten zum Umblättern.
Anmerkungen
- (1) Annet Huizing: Wie ganz zufällig aus meinem Leben ein Buch wurde. Aus dem Niederl. v. Birgit Erdmann. München: Mixtvision 2016. S. 41.
- (2) Renate Habinger/Verena Ballhaus: Kritzl & Klecks. Eine Entdeckungsreise ins Land des Zeichnen & Malens. St. Pölten: Nilpferd in Residenz 2014.
- (3) Sven Nordqvist: Eine Bilderreise. Aus dem Schwed. v. Maike Dörries. Hamburg: Oetinger 2015.
- (4) Daniel Napp: Das schlaue Buch vom Büchermachen. Hildesheim: Gerstenberg 2016.
- (5) Ron Heussen/Anne Mikus/Farid Rivas Michel: Das geheime Leben der Bücher vor dem Erscheinen. Mainz: Hermann Schmidt 2010. S. 72.
- (6) John Agard/Neil Packer: Buch. Mein Name ist Buch und nun erzähle ich euch meine Geschichte. München: Knesebeck 2015. S. 8.
- (7) Lane Smith: Das ist ein Buch! Aus dem Amerik. v. Michael Krüger. München: Hanser 2010.