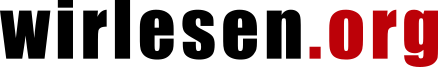Theodora Bauer bloggt: Krankheit zum Schreiben
Lesereisen, Flüge früh am Morgen, überhaupt irgendwas früh am Morgen; viel Packen, nichts vergessen; Termine an unbekannten Orten in schrägen Zeitzonen; die Unordnung, die das ganz normale Reisen mit sich bringt, plus die erhöhte Aufmerksamkeit einer ganz normalen Lesung; mit einem Wort: schöne Erlebnisse, zu viele schöne Erlebnisse, und kaum ist man zu Hause, ist man krank.
Das ist nun bereits das zweite Mal in dieser Saison, dass mir das passiert ist – im Oktober lag ich drei Tage lang stumm die Wände anklagend in einem Frankfurter Hotelzimmer, dessen puritanistischer japanischer Charme unbewegt auf mein vom Fieber schmerzendes Gesicht herniederbrannte. Ich hatte nolens volens genug Zeit, mich auszukurieren; ich musste meine Lesung auf der Messe absagen und fuhr mit einer Stimme wie Rod Stewart zu seinen besten Zeiten wieder ab.
Dieses Mal hat es mich innerhalb von eineinhalb Monaten zuerst nach Paris (winterweiße Stadt, wunderschön), dann in die USA (Leibland, so viele nette Gesichter) und dann nach Budapest (meine erste akademische Konferenz als reguläre Teilnehmerin) verschlagen. Das hat Spuren hinterlassen. Angenehme Spuren in meiner Erinnerung, die ich gerne gedanklich nachverfolge, und offensichtlich auch Spuren in meinem Körper, der sich mir durch einwöchiges Totstellen (ich übertreibe: höllenhundartiges Husten) erst einmal wieder ins Gedächtnis rufen musste.
Ja, es stimmt: Man nimmt den eigenen Körper auch mit auf Lesereisen. Das pflegt man von Zeit zu Zeit zu vergessen. Er schläft jeden Tag in einem anderen Hotelzimmer, fährt mit dem Zug kreuz und quer durchs Land, steigt mit Flugzeugen in einer Klimazone aus und landet in einer anderen. Der Geist sitzt jeden Abend enthusiastisch bei der Lesung und diskutiert mit dem Publikum, aber der Körper ist auch mit dabei, und meldet gehorsamst, zunächst noch verstohlen, dass er auch gerne mal schlafen möchte. Dass er auch gerne mal länger wieder am selben Ort verharren möchte. Dass er auch gerne ein bisschen Gemüse zu sich nehmen möchte, sicher versteht er, dass man auf Reisen nicht eine ganze Obstschale mitschleppen kann, aber dennoch. Und wenn er sich zu lange äußert und man hört ihn nicht vor lauter Flugzeuglärm und Reisegetöse, dann kennt dieses verständnisvolle Verhalten auch seine Grenzen. Dann klinkt er sich mal schnell aus, der Körper, und nimmt einen selbst ungefragt mit in den improvisierten Kurzurlaub.
Das Beste, das man dann tun kann, ist, ihm die Zeit zu geben, die man ihm vorher genommen hat. Ihn zu sich kommen zu lassen. Schlafen wie ein Murmeltier. (Hoffen, dass man Husten bekommt und keinen Schnupfen, denn nichts ist schlimmer als ein vermuteter Erstickungstod in einem japanischen Hotel im Frankfurter Bahnhofsviertel bei geöffnetem Mund und geschlossener Nase.) Überhaupt ist schlafen das Allerbeste. Wenn man ihn lässt, wie er will, dann kehrt der Körper auch wieder zurück und liest bei den Lesungen mit, leistet einem Gesellschaft bei Reisen und Touren zu Land und zu Wasser, kommt mit bis in die entlegenste österreichische Bibliothek; ist also im Wesentlichen ein treuer und größtenteils unkomplizierter Begleiter.
Und die Moral von der Geschicht? Man vergisst so leicht, dass das, was man tut, auch Arbeit ist, weil man es so gerne macht; weil es genau das ist, was man machen möchte. Man sieht die Strapazen nicht; oder zumindest nicht mehr, wenn man wieder auf einer Bühne sitzt und mit interessierten Menschen über den eigenen Text spricht; wenn man wieder eine Anfrage bekommt für den Ort, an dem man doch so lange schon lesen wollte; wenn man noch eine Deadline zu befolgen hat für ein Projekt, bei dem man unmöglich hätte absagen können. Man muss aufpassen, dass einem die eigene Gesundheit nicht verloren geht zwischen all den schönen Erlebnissen und Gelegenheiten; das schuldet man, wenn schon nicht sich selbst, so doch den Texten, die man noch hervorzubringen gedenkt. Denn Texte haben ja schließlich nicht nur einen Kopf, sondern auch einen Körper. Der Körper arbeitet und will pfleglich behandelt werden. Und die Schreibenden, die manchmal ganz selbstvergessen in ihren Körpern sitzen, ebenso.