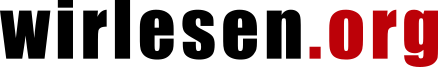Olga Flor bloggt über Aufzeichnungen aus dem Schreibladen
Derzeit, ein Buch gerade draußen, eine Eröffnungsrede zum Thema Kapital Macht Geschlecht fertiggestellt, stehe ich vor der Frage: Wie mache ich aus dem angesammelten Material zur Finanzwirtschaft – leider nur sehr theoretisch angesammelt, da ich ein Gedächtnis habe wie ein Sieb – einen Text? Welcher Zugang ist sinnvoll? Ist ein fiktionaler, erzählender Text in Romanform daraus überhaupt zu destillieren, und wenn, warum eigentlich? Ist die Formulierung des berühmten Narrativs nicht zwangsläufig eine Bestätigung des Konstrukts, in dessen Rahmen es gespannt wird?, eine Frage, die ich persönlich immer mit Nein! beantwortet habe, doch bei diesem Projekt kommen mir anscheinend Zweifel, und die gehen weit über die Fragen der technischen Machbarkeit hinaus, Fragen wie: Wie erfasse ich die Komplexität des Ganzen, wie schlägt sich das markttypische Denken auf die Persönlichkeiten (und die Sprache!) meiner Figuren nieder? Ich versuche also die Mikrotransaktionszeilen der Flashorder als formalen Ansatzpunkt zu nehmen – höre schon das begeisterte Jubeln der Verlagsbranche (Zielpublikum?) – und stelle fest, dass diese Form zwar reizvoll für eine halbe Seite sein mag, doch nicht länger: die Übereinstimmung von Form, Motiv, Konstruktion und Sprache ist keine einfache Aufgabe bei diesem Thema, und die Frage, wenn Narrativ, dann bitte: wie? ist auch noch ungeklärt.
Also beginne ich neu. Erfinde alles von Anfang an neu. Scheitere. Stattdessen erfinde ich Plots für Fantasy-Epen, die ich sicherlich niemals schreiben werde, und nenne sie Was gefragt ist.
Dann folgt sehr kurzfristig eine Einladung zu einem Symposium in Peking, Frauen schreiben mit der Bitte um eine Eröffnungsrede. Da stellen sich ganz andere, schwerwiegendere Fragen, und primär die von Bezeichnendem und Bezeichnetem in verschiedenen politischen Systemen, von Kurzschlüssen und Hyperraumumgehungsstraßen und inwiefern die Korrelation zwischen den beiden kontextunabhängig zumindest soweit nachvollziehbar ist, dass ich mich als in einem europäischen demokratischen System geformte Schriftstellerin verständlich machen kann, ich versuche es also, und betone die Beschränkung auf den deutschsprachigen Raum, in der Hoffnung, dass die Beschränkung aufs Spezielle die Öffnung des Blicks für das Allgemeine ermöglicht:
Frauen schreiben. Ja, Frauen schreiben, in der Tat. Männer auch, und auch Menschen jenseits der dualen Zuschreibung. Ich sehe einen solchen Titel und befürchte sofort Fragen in der Art, wie man sie mir regelmäßig stellt, wenn die Rede auf die Tatsache kommt, dass ich einen Abschluss in Physik habe: „Und wie schlägt sich nun die naturwissenschaftliche Ausbildung in ihrer Literatur nieder?“
Darauf kann ich dann nur antworten, dass ich das nicht beantworten kann, da ich schließlich nicht weiß, wie ich schreiben würde, wenn diese Voraussetzung nicht gegeben wäre. Allerdings ist die Schulung in analytischem Denken sicher eine Hilfe bei der Arbeit an der ewigen Baustelle Sprache, dazu bedarf es aber keiner naturwissenschaftlichen Ausbildung. Für mich persönlich war es vielleicht noch wichtiger, zunächst einen gewissermaßen geerdeten Berufsweg einzuschlagen, was ich als Programmiererin und Multimediadesignerin dann auch tat, wenn man dieses Berufsfeld denn als geerdet bezeichnen kann. Und auch hier bleibt die Frage nach dem Schreiben unter anderen Ausgangskonfigurationen und Rahmenbedingungen unbeantwortbar. Ich möchte also nicht den – in meinen Augen müßigen – Versuch anstellen, darüber zu spekulieren, wie ich schreiben würde, wäre ich keine Frau.
Worauf ich aber zu sprechen kommen möchte, ist, dass, und ich möchte mich hier speziell auf den deutschsprachigen Raum beziehen, die Fragen sozialer Verwerfungen Frauen oft noch ein wenig mehr treffen als Männer. Dass Frauen etwa in Österreich und Deutschland immer noch deutlich weniger mit vergleichbarer Arbeit verdienen als Männer (ja, dass die Frage der Vergleichbarkeit, also der Paradigmen des Referenzsystems, über die monetäre Einordung Genderdifferenzen fortführt). Dass Frauen vor allem in traditionell patriarchal geprägten Strukturen, wie sie lange auch in Europa vorherrschten, weniger Mitsprache haben, schlechteren Zugang zu Bildung, Arbeitsmarkt und Gesundheitsversorgung, weniger Autonomie in der Wahl der Lebenspartner, bei privaten und beruflichen Entscheidungen haben als Männer. Ich denke, dass dieser Umstand die Sinne schärft, schärfen muss, und dass es für Frauen vielleicht ein wenig weniger Möglichkeiten gibt, die Augen vor den sozialen Realitäten zu verschließen als für diejenigen, deren Lebensentwurf erklärtermaßen das Maß ist, an dem sich der gesellschaftliche Mainstream misst. Dies kann, muss aber nicht, das Schreiben beeinflussen. Es kann zum genauen Hinsehen führen, zum Hinhören, zum seismografischen Aufspüren von Spuren von Machtgefällen und Ungerechtigkeiten in der Sprache, in ihrer Doppelbödigkeit, in der subtilen oder offenen Falschheit, die sie an den Tag zu legen im Stande ist, doch auch in ihrer sich manchmal geradezu freudvoll selbst entlarvenden Offenheit: da heißt eine Ratingagentur zum Beispiel Moody. Der Name einer anderen erinnert an einen sehr mäßigen – also auf Englisch: poor –Standard. Eine Investmentbank nennt sich Chase, eine andere gar Lynch. Könnte ich mir nicht besser ausdenken, und selbst wenn, hieße es wohl, das sei aber nun wirklich zu dick aufgetragen.
Apropos Ökonomie: So sehr man oder frau über soziale und wirtschaftliche Bedingungen nachdenken und schreiben kann, so sehr ist er oder sie gleichzeitig auch Teil eines Marktes, des sogenannten Literaturbetriebs. Anders gesagt: nur wenn ich in ausreichend marktkompatibel agiere, wird meine Literatur wahrgenommen. Das gilt nun prinzipiell für alle, das Problem scheint mir zu sein, dass der Literaturbetrieb stereotype Rollen vergibt, und die werden gerne jedes Jahr neu besetzt und schränken in ihren Vorgaben Frauen vielleicht noch ein wenig mehr ein als Männer: Gefragt ist die Erkennbarkeit der Figur des Autors/der Autorin in den Texten, ein durchdesigntes Gesamtpaket, und das soll, in Marktneusprech ausgedrückt, sexy sein, wobei hiermit die Attraktivität in Hinblick auf die Verkaufszahlen gemeint ist. Da schadet es aber trotzdem nicht, wenn der Autor/die Autorin jung und schön ist. Kann man dieser Anforderung nicht entsprechen, hat man oder frau Pech gehabt, wobei, auch wie überall sonst, der Jungschönheitsdruck deutlich mehr auf den Frauen lastet als auf den Männern. Die prinzipielle Inkompatibilität, der innere Widerspruch, der in jedem Versuch liegen muss, einen Markt gleichzeitig zu kritisieren und zu bedienen, spitzt sich hier geradezu körperlich zu.
Nimmt man die österreichische Literatur, so scheint es mir deutlich, dass diejenigen Stimmen, die sich explizit und implizit mit aktuellen Zeitthemen auseinandersetzen, sehr oft die von Frauen sind. Als Pionierin ist die Sprachseziererin Elfriede Jelinek zu nennen. Die Erfahrung von Jelineks, wie ich es nennen möchte, Schule des der Sprache aufs Maul Schauens war für mich, wie für viele meiner Kolleginnen, ganz offenkundig eine prägende Erfahrung. Wobei das keinesfalls heißen soll, dass diese Autorinnen in ihren literarischen Texten stets eine bestimmte Agenda beleuchteten, das können Sachbücher und Essays diskurstechnisch besser, eher dass – wie im Fall von Jelineks Klavierspielerin oder den Liebhaberinnen –, den Figuren die gesellschaftlichen und damit die politischen Rahmenbedingungen gewissermaßen unter die Haut wachsen, dass wir ihnen dabei zusehen können, wie sie sie verinnerlichen, und was das mit ihnen tut, mit ihrem Denken, ihrem Fühlen, ihrer Sprache, denn schließlich sind mit Wittgenstein die Grenzen meiner Sprache die Grenzen meiner Welt, wobei man natürlich einwerfen kann, dass sich Welterfahrung sehr wohl auch nonverbal festhalten lässt, und ja, es ist grotesk, ausgerechnet mit Ludwig Wittgenstein zu enden, der nun bekanntermaßen nicht allzu viel von denkenden Frauen hielt, mehr noch, der ihnen die Weiblichkeit absprach, indem er sie als Mann bezeichnete, was er wohl als Kompliment verstanden wissen wollte, heute jedoch nur noch wie die hegemoniale Herablassung dasteht, die es tatsächlich auch war. Nebenbei bemerkt, sagt das einiges aus über die österreichischen Verhältnisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dennoch trifft dieser Satz über die Sprache als Bedingung des Denkens diese wechselseitige Rückkopplung sehr genau, und ich denke, dass das genaue Hinsehen das ist, was Arbeit mit und an Sprache lohnenswert und vergnüglich macht, nicht zuletzt für die Leserinnen und Leser.