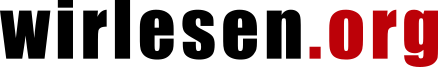Cornelia Hülmbauer bloggt: Wo bitte ist mein Wasserglas?
Ich bin Dichterin. Ich stehe im Kunstmuseum. Zusammen mit einem guten Dutzend KollegInnen stehe ich da, Freitag 19:00, und warte auf Publikum. DichterInnen als Ausstellungssubjekte. Wir sind beauftragt. Wir haben uns verteilt. Alle Räume sollen gleichzeitig bespielt werden. Wir steigen von einem Bein auf das andere, lauschen angestrengt, bis wir endlich Schritte hören. Ich stehe in der Tür des mir zugeteilten Raumes und sehe die BesucherInnen in den benachbarten Hauptraum kommen. Ein dort positionierter Kollege fängt an, einen Text zu sprechen. Die BesucherInnen gehen auf ihn zu. Da zieht eine Kollegin vor dem mir gegenüberliegenden Raum effektvoll an einer Papierrolle, die von ihren Händen bis auf und über den Boden reicht, und liest mit kräftiger Stimme von ihr ab. Das Publikum wendet sich ihr zu und macht sich langsam in ihre Richtung auf. Ich werde unruhig. Auch in unserem Bereich ist bereits Programm. Allein, die Worte der sich hinter mir befindlichen Dichterin dringen akustisch nicht weit genug, um jemand anlocken zu können. Ich überlege. Ich überlege nicht lange. Bevor die Gruppe an der gegenüberliegenden Tür ankommt, beginne ich, bestimmt und sehr laut, ein Gedicht zu deklamieren. Die Dichterin als Marktschreierin. Leute drehen sich zu mir. Ich spreche weiter, wende mich vom Publikum ab und unserem Raum zu. Die Dichterin als Rückenfigur. Inmitten abstrakter Kunst lenke ich auf höchst figurative Weise die Aufmerksamkeit der Betrachter. Tatsächlich, einige Personen sind mir gefolgt und gelangen schließlich zur Hauptattraktion unseres Raumes – die Performance der Dichterin auf einem Podest.
Ja, auf einem Podest. Genauer gesagt auf einer Bank, die die MuseumsbesucherInnen bei Tag zum Verweilen vor den Kunstwerken einladen soll. Wir brauchen eine Bühne. Wir brauchen einen Status. Wir teilen die Aufmerksamkeit der BesucherInnen nicht nur mit den KollegInnen in den anderen Räumen, wir teilen sie auch mit den Gemälden an der Wand. Wir erwarten nicht, dass unsere Texte reichen. Wir müssen mehr tun.
Attraktiv machen.
Beweglich sein.
Keine Wassergläser halten. Unterhalten.
In Augen blicken. Aufsehen erregen.
Und bitte n i c h t sperrig sein.
DichterInnen als PerformerInnen. Wir nehmen die Rolle an. Wir füllen sie ganz oder halb oder zu einem Bruchteil aus. Wir füllen sie zu einem guten Teil deshalb, bemühen uns zu füllen, weil dies gefordert wird. Von Institutionen, KuratorInnen, etc. Weil Lyrik allein verstaubt und als Spektakel zeitgemäßer scheint? Weil Komplexität mehr braucht als eine Stimme, um vermittelbar zu sein? Ich verstehe. Aber.
Und. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich mag Performances. Ich mag umso lieber Performances, deren Sprachmaterial auf ein solches Format ausgerichtet wurde, also ein Textkonzept, das Körper und Raum von Anfang an mitdenkt, zumindest als Möglichkeit. Performances, die Menschen involvieren, produktiv wie rezeptiv Interagierende, die sich aus sich heraus auf die flexible situative Form einlassen wollen.
Ich mag allerdings auch klassische Lesungen. Ich mag das rituelle Nippen am Wasserglas (das, zumindest mir, weniger Mittel zur Kehlenbefeuchtung als Requisite ist – ertappt, eine Aufführung, auch hier, die Grenzen sind wässrig). Ich mag die Formelhaftigkeit der Moderation, die kleinen Souveränitäten und Unsouveränitäten der Menschen als DichterInnen. Apropos un/souverän. Ich finde es nicht zwingend besser, wenn ein Text, anstatt vom Blatt gelesen, frei gesprochen wird. Letzteres lässt wohl mehr Effekte zu und mehr Interaktion mit dem Gegenüber. Sicherlich distanziert man sich beim Ablesen vom Publikum. Wahrscheinlich distanziert man sich beim Ablesen auch von den eigenen Texten. Auf eben diese Weise lässt man jedoch auch freien Raum. Oder schafft diesen erst. Raum zur Interpretation der Texte, und zwar zweifach, für die Verstimmlichenden genauso wie für die Zuhörenden.
In ihrem sehr lesenswerten Beitrag Im Störfall: Flattern im Logbuch Suhrkamp berichtete die Dichterin Anja Utler unlängst über ihre Erfahrung mit Literaturperformance, auswendig aufsagen und Blickkontakt. Über das Publikum während des performativen Aktes schreibt sie: „Obwohl die Räume für die Zuhörer anders waren, als bei der üblichen Lesung, bin ich überzeugt, dass keinerlei Gewaltsamkeit im Spiel war. Es gab für sie weiterhin genügend Handlungsoptionen: Augen schließen, wegschauen, gehen, zustimmungsfrei zurückschauen, um nur einige zu nennen.“ Handlungsoptionen sind da, und das ist genau der Punkt. Die Performance verlangt dem Publikum Handlungen, reaktive körperliche Positionierung zum Geschehen, gewissermaßen ab.
Die Strukturen und Rollenverteilungen von klassischen Lesungen sind hingegen großteils bekannt, ihre ungeschriebenen Regeln werden nicht unterlaufen. Das mag statischer sein. Das schafft aber auch Konzentration. Ich mag das, und ich schätze es, als Zuhörende genauso wie als Vorlesende. Ich schätze es, dass dadurch die verstimmlichten Worte leuchten können. Dass für gewisse Momente alles hinter sie zurücktritt, alle Anregung und Irritation direkt aus ihnen und durch sie kommt.
DichterInnen als VorleserInnen mögen weniger in Augen sehen, sie drehen aber auch keine Rücken zu. Sie stehen weniger im Raum als sie etwas in die Luft legen. Manch eine_r mag das langweilig finden. Ich finde, manchmal kann das magisch sein. In diesem Sinne: Prost. Auf die Literatur!